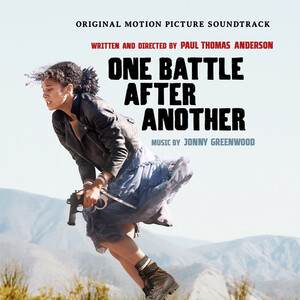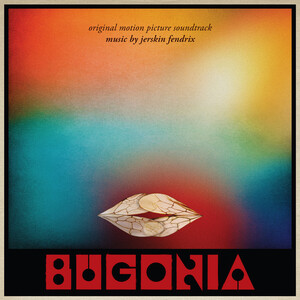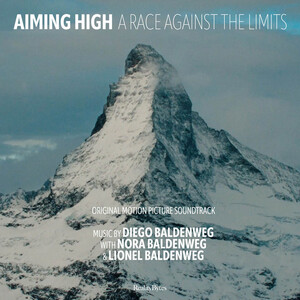Louisa May Alcotts Historienroman Little Women von 1868/69 gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Werken der US-Literatur. Kein Wunder also, dass das Buch bereits unzählige Male verfilmt wurde. Die beiden bekanntesten Adaptionen waren bislang Kleine tapfere Jo (1949) mit Elizabeth Taylor und Betty und ihre Schwestern (1994) mit Winona Ryder in der Hauptrolle. In diese Liste gehört nun seit 2019 auch die Adaption der späteren Barbie-Regisseurin Greta Gerwig. Sie hat die Gelegenheit genutzt, um die Geschichte der Geschwister Meg, Jo, Beth und Amy, die in Abwesenheit des Vaters aufwachsen und um ihren Platz im Leben kämpfen, kräftig gegen den Strich zu bürsten. Auffälligster Unterschied zu den filmischen Vorgängern und der Romanvorlage ist die nicht-lineare Erzählweise, die das Leben der jungen Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen gegenüberstellt. Gleichzeitig verleiht das von Gerwig selbst verfasste Drehbuch den March-Töchtern ein deutlich stärkeres Profil: In ihrer Interpretation verfügt nicht nur die aufstrebende Schriftstellerin Jo über ein künstlerisches Talent. Auch ihre Schwestern können weit mehr als allein dem Heiratsmarkt zur Verfügung zu stehen: Amy zeichnet hervorragend, Beth spielt exzellent Klavier und Meg träumt von einer Karriere als Tänzerin. Gleichzeitig legt das Drehbuch viel Wert darauf, den schwierigen Lebensumständen von Frauen im 19. Jahrhundert durch präzise Dialoge Ausdruck zu verleihen. Dabei verwendet Gerwig einen bemerkenswerten Kunstgriff: Weil Little Women ohnehin ein stark autobiographischer Roman ist, arbeitet sie Details aus Louisa May Alcotts echtem Leben in das Drehbuch ein: Etwa wird der Film auf vielschichtige Weise vom Streit mit ihrem Verleger um Tantiemen, Copyright und das “richtige” Ende für das Buch eingerahmt.

So offenbart das finale Happy End, bei dem schließlich auch Jo “unter die Haube kommt”, einen doppelten Boden, der clever auf die idealisierte Darstellung im Roman als auch innerhalb der Verfilmung hinweist. Komplett löst sich Gerwigs Adaption aber nicht von der Vorlage. Die wesentlichen Plotelemente und Handlungsbögen bleiben erhalten. Durch das Vor- und Zurückspringen in der Zeitachse entwickelt sich aber fast zwangsläufig keine klassische Spannungsdramaturgie, die mit dem Schicksal der Hauptfiguren mitfiebern ließe. Stattdessen rückt der Film die Geschichte stärker auf eine Metaebene und lädt dazu ein, sich mit den Rollenerwartungen, Lebenszielen und dem Ideal von Partnerschaft und Ehe auseinanderzusetzen. Neben dieser feministischen Perspektive ist Little Women zugleich aber ein sehr poetisch inszenierter Film, der viel Wärme ausstrahlt. Erheblichen Anteil daran hat die impressionistische Kameraarbeit von Yorick Le Saux. Zum Niederknien schön filmt er die Strandszenen: Die fröhliche Stimmung des ersten Ausflugs fängt er mit einer leuchtenden, sandig-blauen Farbpalette ein. Ein Zeitsprung bringt allerdings dunkle Wolken. Die Farben sind plötzlich entsättigt. Die Botschaft ist klar: Es steht nicht gut um Beth. Ihr geht es nach einer Scharlach-Erkrankung gesundheitlich immer schlechter.
Alexandre Desplat eröffnet mit seiner Oscar-nominierten Filmmusik eine weitere ästhetische Ebene: Den Alltagsgeschichten der heranwachsenden Frauen stellt er eine verspielt wirkende, feinteilige Komposition gegenüber, die von einer europäischen Sensibilität geprägt ist, zugleich aber auch unmittelbar an vorangegangene eigene Werke anknüpft. Streicher, Klavier, Harfe und Holzbläser bilden einmal mehr die Basis für seine reizvollen Miniaturen, die mit viel Empathie die Filmhandlung nachzeichnen, ohne jemals in allzu großen Kitsch zu verfallen. Auffällig ist dabei die Abwesenheit eines dominanten Hauptthemas. Zwar gibt es Einzelmotive für die handelnden Figuren. Die sind aber so subtil in die Komposition eingewoben, dass sie kaum im Sinne klassischer Leitthemen agieren. Überraschend unscheinbar ist etwa das Leitmotiv für Jo (zu hören z.B. in Jo Writes oder Plumfield), eine Klaviermelodie, die wohl nur die wenigsten nach dem Sehen mit ihrer Figur verbinden würden. Dennoch verwendet Desplat die Charakter-bezogenen Themen, um flüssige Übergänge bei den Zeitsprüngen herzustellen. Besonders stark gelingt ihm das bei der oben bereits beschriebenen Strandszene (The Beach): Während das Walzer-artige Thema für Beth anfangs noch ausgelassen das fröhliche Treiben der Geschwister begleitet, wird es im zweiten Teil des Stücks langsam und zögerlich von der Solo-Harfe und dann schließlich nur noch vom Klavier gespielt. Jegliche Fröhlichkeit der Kindheit und Jugend ist auf einen Schlag verschwunden.
Dieses feinsinnige Spiel mit Transitionen, Stimmungswechseln und subtil ineinander greifenden Klangschichten bildet ein bestimmendes Grundprinzip von Desplats Filmmusik. Fröhliche Klavierläufe und quirlige Scherzi in den Streichern kontrastieren immer wieder mit melancholischer Streichermelodik oder ruhigem Klavierspiel in den ernsten Szenen, in denen die Unbeschwertheit der Jugend zur Erinnerung verblasst. Doch das geschieht aufgrund der Zeitsprünge oft derart sprunghaft, dass die Musik mitunter eine Spur zu geschäftig und kurzatmig wirkt. Desplats Komposition steht und fällt deshalb mit der Qualität der einzelnen Stücke. Glücklicherweise ist der routinierte Franzose bei Little Women überwiegend mit viel Liebe zum Detail unterwegs, sodass die Musik einigen Charme versprüht. Die spöttischen Einwürfe der Klarinette in The Book oder das eindringliche Telegram sind nur zwei von vielen Höhepunkten, zu denen auch das unverblümt romantische und gleichzeitig gewollt übermütige Finale It’s Romance zählt. Dennoch gehört die kammermusikalische Filmmusik nicht zu den großen Meilensteinen in Desplats Karriere. Dafür klingt sie im Grunde zu ähnlich wie viele andere in seiner Karriere auch und ist gleichzeitig nicht charismatisch genug, als dass man sie untrennbar mit Greta Gerwigs ambitionierter Literaturverfilmung verbinden würde. Das hat freilich auch viel mit der filmischen Vorlage zu tun: Schenkt man dem Begleittext der Filmmusik Glauben, sollte die Musik laut Greta Gerwig folgende Attribute erfüllen: “schön, aber nicht süßlich“, ” episch, aber nicht die Schauspieler erdrückend“, “tragisch ohne manipulativ zu sein” und “intelligent ohne Überheblichkeit“. Ein ziemlich enger Rahmen, der vielleicht erklären mag, warum Desplats Komposition bisweilen eine Spur zu unverbindlich klingt.