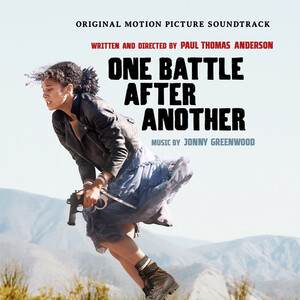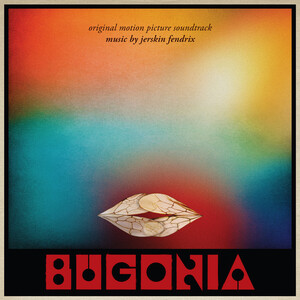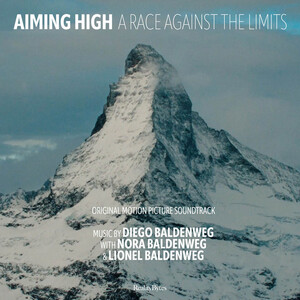Das siebte Kapitel von Bram Stokers Dracula-Roman berichtet von den Aufzeichnungen des Kapitäns der Demeter. Das dreimastige Handelsschiffs ist unterwegs von Bulgarien nach London und trägt eine besondere Fracht: eine Reihe mysteriöser, mit Sand gefüllter Holzkisten. Während der Überfahrt spielen sich an Bord schreckliche Ereignisse ab, viele Tote sind zu beklagen. Als das Schiff letztendlich die englische Küste erreicht, ist die gesamte Besatzung verschwunden und Graf Dracula erreicht sein Ziel London. Der Horrorfilm Die letzte Fahrt der Demeter macht aus dieser Alien-verdächtigen Prämisse – die Besatzung wird nach und nach von einer monströsen Kreatur dahingerafft – eine abendfüllende Angelegenheit. Ein wenig sonderbar erscheint diese Idee schon, zumal jeder Zuschauer bereits das Ende kennt, noch bevor die Demeter überhaupt den Hafen verlassen hat. Entsprechend geht es in André Øvredals Film auch mehr um den Weg als das Ziel. Aufgrund der Knappheit des Romankapitels muss vieles ergänzt und aufgefüllt werden: Das Drehbuch bringt deshalb neue Figuren ins Spiel: Dazu gehören der afrikanische Arzt Clemens (Corey Hawkins), der in Cambridge studiert hat und nun die Reise in seine Heimat antritt und eine entkräftete junge Frau, die Clemens unterwegs den Fängen Draculas entzieht. Und der Kapitän Eliot (Liam Cunningham) hat den tüchtigen Jungen Toby mit an Bord gebracht, im Versprechen, ihn gesund nach England zu überführen.
Von da an läuft vieles leider sehr vorhersehbar ab: Nacht für Nacht dezimiert sich die Crew um ein weiteres Mitglied. Wie so oft im Horrorfilm trifft es dabei Neben-Charaktere als erstes. Und die Mannschaft ist, gefangen auf See, verdammt dazu, dem unheilvollen Vampir-Treiben tatenlos zuzusehen. Die schicksalshafte Vorbestimmung erlaubt nur wenig Handlungsspielraum für die Figuren und erzeugt auch nur wenig Spannung. Das, was Broker in der Romanvorlage der Fantasie des Lesers überlässt, wird in Die letzte Fahrt der Demeter komplett auserzählt – und das geschieht nicht einmal sonderlich schlüssig. Man fragt sich als Zuschauer schnell, warum die Mannschaft nicht einfach bei Tageslicht die unheilvolle Fracht über Bord wirft oder das durchaus vorhandene Rettungsboot nutzt, um sich zur nahe gelegenen Küste abzusetzen. Und wenn Dracula sogar fliegen kann, warum benötigt er dann überhaupt ein Schiff? Das Drehbuch strotzt nur so vor solchen Fehlern. So muss sich Die letzte Fahrt der Demeter vor allem auf seine Schauwerte verlassen. Und die können sich zumindest sehen lassen: Die in Malta gedrehten Hafenszenen wirken ebenso eindrucksvoll wie das voluminöse Schiffsset, das in einem Tank mit viel Aufwand errichtet wurde. Szenen unter Deck wurden wiederum in Babelsberg gedreht und manche Kameraeinstellung erinnert tatsächlich an die Nostromo aus Ridley Scotts Alien. Dass Die letzte Fahrt der Demeter trotz aller Schwächen passabel unterhält, liegt auch an den charismatischen Schauspielern. Allen voran Liam Cunningham (Game of Thrones) als Kapitän und Aisling Franciosi als Anna beleben die Handlung durch ihre starke Leinwandpräsenz.

Das tragische Schicksal der von Dracula verschleppten Anna rührt dabei besonders an. Bear McCreary gibt ihrer Figur in seiner Filmmusik durch ein pastorales Thema auf der Solovioline eine Vergangenheit, erinnert an ihre Herkunft als einfaches Bauernmädchen. Es ist ein besonderer melodischer Akzent in einer Vertonung, die ansonsten merklich von der Rock’n-Roll-Sensibilität des Komponisten bestimmt wird. André Øvredals Adaption reduziert den Vampir nämlich auf ein fratzenhaftes Monster und interessiert sich wenig für die Vorgeschichte oder den historischen Kontext der Romanfigur. Folglich zielt auch McCrearys Musik mehr auf den vordergründigen Effekt als den zugrundeliegenden Mythos ab: Das Drei-Noten-Motiv für Dracula hämmert sich, in Anlehnung an das Klopfen des drachenförmigen Gehstocks des Fürsten der Finsternis, wie ein Fanal in die Gehörgänge. Das verfehlt nicht seine Wirkung, erscheint zugleich aber auch etwas anachronistisch für eine dem klassischen Gruselfilm verpflichtete Produktion.
Dazu passt auch die moderne Klangästhetik, die durch die Nachbearbeitung am Computer und elektronische Texturen die Stilismen des modernen Horrorkinos bedient. Der omnipräsente Chor klingt zum Teil derart undifferenziert, dass man sich fragt, ob er nicht künstlich erzeugt wurde, obwohl das nachweislich nicht der Fall ist. Anders als bei Wojciech Kilars Musik zu Coppolas Dracula-Verfilmung von 1992 fehlt hier ein tiefergehendes Gespür für die historischen und geografischen Dimensionen des Stoffes. Das war wohl auch gar nicht gewollt, denn Øvredal verortet seinen Film – und die Musik trägt ihren Teil dazu bei – eindeutig im schnelllebigen Unterhaltungskino. Großes Interesse am Dracula-Mythos zeigt er über weite Strecken nicht. Stattdessen suggeriert das Filmende sogar eine mögliche Fortsetzung – was in Kenntnis der Romanvorlage wenig Sinn ergibt. Und so wird auch verständlich, warum McCreary so viele Kompromisse an das gegenwärtige Blockbuster-Kino eingehen musste.
Erfreulicherweise macht seine Musik abseits der Bilder eine deutlich bessere Figur. Das liegt insbesondere daran, dass der Komponist selbst eine knackige, 35-minütige Albumfassung erstellt hat, die sich ganz auf die thematischen Höhepunkte konzentriert und laute Actionpassagen geschickt mit ruhigen Stücken ausbalanciert. Nach dem furiosen Hauptthema begleitet McCreary etwa die Vorstellung der Mannschaft in Meet my Crew mit dem Spiel des Hackbretts und warmer Streichermelodik, die die Ambitionen und Träume jedes einzelnen in den Mittelpunkt rückt. Das markante Dracula-Motiv kontert diese Hoffnungen zwar rasch und wird die Handlung unermüdlich vorantreiben. Doch geben Drehbuch und Musik den späteren Opfern hier ein menschliches Gesicht. Zusätzlich verleiht das melancholische Anna-Thema (sehr stimmungsvoll in Delusional Grief und In the Lantern’s Light zu hören) der Komposition einen besonderen emotionalen Ankerpunkt. Beide Stücke sind merklich gezeichnet vom unheilvollen Schatten, der über der Demeter liegt, und der verzweifelten Ahnung, dass für niemanden an Bord ein Entkommen möglich sein wird.
Bear McCreary macht in diesen, vielleicht auch besten, Szenen des Films die ganze Dimension der tragischen Ereignisse spürbar. Es sind Momente, in denen er die Mechanik des rastlosen Blockbuster-Kinos verlässt und innehält. Ganz entgehen kann er dieser natürlich trotzdem nicht. Bemerkenswert ist aber, dass McCreary in einem Jahr, in dem er für das Mammut-Projekt Die Ringe der Macht viele Stunden Musik zu komponieren hatte, ein solches Projekt überhaupt noch stemmen konnte. Wenig überraschend listet der Abspann gleich vier beteiligte Co-Komponisten. Hören tut man das aber nur bedingt. Allein der Chor-Einsatz klingt bisweilen etwas generisch und manche Suspense-Passage fällt zu stereotyp aus. Das mag aber auch dem hohen Zeitdruck geschuldet sein. Die kurzweilige Vertonung zu Die letzte Fahrt der Demeter unterhält diesen Einschränkungen zum Trotz dennoch bestens. Dafür sorgt letztendlich auch die kompakte Repräsentationsform, mit der McCreary ganz nebenbei auch ein überzeugendes Plädoyer für kürzere, sorgfältig kuratierte Filmmusik-Alben liefert.