Der blaue Planet der Na’vi klingt musikalisch sehr irdisch. Nach Weltmusik. Nach Afrika, Indien, Südamerika und ein wenig nach Carl Orffs Carmina Burana. Wirklich überraschen konnte das 2009 nicht, als James Horner seine Komposition für James Camerons 3D-Spektakel Avatar präsentierte. In mancher Kritik war bereits von kultureller Aneignung zu lesen und davon, dass die Filmmusik es sich zu einfach mache, indem sie lediglich verschiedene weltmusikalische Vorbilder zu einer Klangsprache fusioniere. Doch eine solche Kritik missversteht natürlich, dass eine Hollywood-Großproduktion mit einem Budget von mindestens 237 Millionen US-Dollar zwangsläufig möglichst massenkompatibel sein muss und keine Experimente eingehen darf, um ein kostendeckendes Einspielergebnis nicht zu gefährden. So verwundert es auch nicht, dass Cameron eine eher einfache Geschichte erzählt, die starke Parallelen zu Der mit dem Wolf tanzt von Kevin Costner und Pocahontas aufweist, den Plot aber ins Weltall verlegt: In einer nicht näher definierten Zukunft hat die Menschheit im All den Planeten Pandora entdeckt, auf dem Konzerne den begehrten Rohstoff Unobtainium abbauen. Das englische Wort „unobtainable“ steht für unbeschaffbar und dieser Name ist tatsächlich Programm. Denn auf Pandora leben die blauen Na’vi, und die sitzen mit ihren Dörfern sprichwörtlich auf dem begehrten Rohstoff und leisten erbitterten Widerstand gegen die gewaltsame Plünderung und den Kahlschlag ihres Planeten.

Doch immer dann, wenn Konzerninteressen im Spiel sind und Aussicht auf sehr viel Geld besteht, kennen Invasoren keine Gnade. Der Hardliner Miles Quaritch (Stephen Lang) möchte das Naturvolk am liebsten komplett ausrotten. Die Initiative der Anthropologin Grace (Sigourney Weaver) setzt hingegen darauf, die Na’vi zur Kooperation zu bewegen. Der an den Rollstuhl gefesselte Ex-Marine Jake Sully versucht zusammen mit den anderen Wissenschaftlern, Kontakt mit der fremden Kultur aufzunehmen. Dabei kontrollieren sie via Bewusstseinsübertragung im Genlabor gezüchtete Na’vi-Avatare, synthetische Zwillinge in Blau. Sully hat gleich bei seinem ersten Einsatz, bei dem er von seiner Gruppe getrennt wird und die Nacht im Dschungel verbringen muss, Glück im Unglück: In letzter Sekunde rettet ihn die Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) vor dem Angriff hyänenartiger Bestien. Und weil ihm die religiöse Macht Eywa wohlgesonnen ist, nimmt Neytiri ihn sogar mit in ihr Dorf. Fortan darf er als “Auserwählter” die Lebensweise des Volkes kennenlernen. Mit jedem neuen Tag gerät Sully dadurch immer mehr in einen Gewissenskonflikt. Eigentlich soll er die Na’vi ausspionieren. Spätestens aber, als er sich in Neytiri verliebt und eines Tages schweres Gerät anrollt, um die Heimat der Na’vi niederzuwalzen, schlägt er sich endgültig auf die Seite der nativen Einwohner, die dem feindlichen Militär technisch allerdings kaum etwas entgegensetzen können.

Es ist schon eine sehr triviale Geschichte, die James Cameron hier erzählt. Die kunterbunte Welt von Pandora ist voller Esoterik und Ökokitsch. Avatar kritisiert eine Menschheit, die sich in der Zukunft zu weit von der Natur entfernt hat und dabei ist, sich selbst zu zerstören. Mit der Reise in dieses Fantasy-Naturparadies feiert der Film die Rückkehr zum Ursprünglichen, zum einfachen Leben im Einklang mit Natur und Gott. Die Ironie dabei ist nur, dass er selbst hinter den digitalen Bilderwelten ein knallhart durchkalkuliertes Hightech-Produkt ist, das ohne die Errungenschaften der Moderne undenkbar wäre. Durch ein extra für den Film entwickeltes stereoskopisches Kamerasystem und den konsequenten Einsatz von Motion-Capturing entstand die Welt von Pandora nahezu komplett virtuell. Gleichzeitig muss man auch hinterfragen, welches Gesellschaftsideal Cameron da eigentlich anpreist. Denn die Na’vi leben in einer strengen, unbedingten Gehorsam einfordernden Hierarchie, an deren Spitze religiöse Anführer stehen. Das kann nur dann nach verlockender Freiheit klingen, wenn man selbst zum Anführer aufsteigt wie Sully. Und auch das vermeintliche Leben im Einklang mit der Natur hat in dem Moment Grenzen, in dem die Na’vi jagen gehen oder Tiere wie die drachenähnlichen Ikran domestizieren. Doch solcherlei Einwände sind letztlich müßig, denn in Avatar geht es um die großen Gesten, die großen Bilder – einen immersiven, bildgewaltigen Weltbau. Und der gelingt James Cameron auf mitreißende, jegliche kritischen Einwände beiseiteschiebende Weise. Egal, ob in 2D oder 3D: In beiden Versionen ist Avatar ein vorher nie dagewesenes visuelles Spektakel, das zum Staunen und Bewundern einlädt, auch wenn manche Szene im ersten Drittel kurzzeitig den Eindruck erweckt, man würde einen Animationsfilm von Pixar schauen. Doch über weite Strecken kann man sich kaum sattsehen an den wundersamen Bildern, dem fluoreszierenden Nachtleben, dem Blick auf die hängenden Berge oder den spektakulären Ikran-Flügen vorbei an gigantischen Wasserfällen, die von den Flügeln der Tiere sanft touchiert werden. Und wenn dann Quaritch mit Waffengewalt ganze Landstriche in Schutt und Asche verwandelt, fühlt man als Zuschauer in sich zwangsläufig beinahe eine ähnliche Wut aufsteigen, als wären es reale Zerstörungen irgendwo auf der Erde.
Dass Avatar als begeisterndes Kintopp so herausragend gut funktioniert, liegt auch an der Filmmusik von James Horner. Die Karriere des Komponisten hatte in den Jahren vor 2009 im Grunde ihren Zenit bereits überschritten. Seine ganz großen Filmmusiken gehörten damals schon der Vergangenheit an und er wurde oft gescholten, sich ständig selbst zu wiederholen. Auch Avatar kann ihn nicht gänzlich von dieser Kritik freisprechen. Erneut gibt es zahllose stilistische Parallelen zu seinen anderen Werken, ob nun Apollo 13, Braveheart oder Titanic. Doch im Unterschied zu vielen Routine-Jobs im Spätwerk genoss Horner hier eine ungewöhnlich lange Vorbereitungszeit, um den speziellen Sound für Pandora und die Na’vi zu entwickeln. Natürlich stimmt es, dass sich die Klangwelt mit ethnischen Trommeln, Flöten, Vokalisen und Chorgesängen stets auf konkrete weltmusikalische Vorbilder bezieht. Wirklich fremdartig klingende Klangräume, in einer Form, wie sie Hans Zimmer viele Jahre später für Dune schuf, sucht man deshalb in Avatar vergeblich. Doch das hätte hier wohl auch nicht gepasst. Denn während die Welt des Wüstenplaneten feindselig ist, inszeniert Cameron Pandora als esoterisches Eskapismus-Versprechen, ein blaues Naturparadies im Weltall. Entsprechend fällt der Komposition Horners in erster Linie die Aufgabe zu, die Wirkmacht der Bilder zu unterstützen. Und diese Aufgabe erfüllt sie äußerst geschickt. Szene für Szene, je tiefer Sully in die Welt der Na’vi vordringt, führt er immer mehr Exotismen ein. Während sich das Staunen am Anfang in den ersten Kameraeinstellungen noch auf das Raumschiff und den Blick aus der Ferne auf den Planeten bezieht – Horner untermalt diese Szenen mit zurückhaltenden Vokalisen im Apollo-13-Modus – steigert er mit jedem Schritt von Sullys Avatar hinein in die bunte Welt Pandoras die “exotischen” Elemente. In den ersten Stücken sind vor allem Andeutungen zu hören. Mal flüstert oder raunt der in einer Fantasiesprache singende Chor leise im Hintergrund, manchmal setzen kurz Flöten ein oder setzt ein flüchtiger Trommel-Rhythmus ein, und mal fängt funkelnde Percussion die Faszination Pandoras ein. Wunderschön ist in dieser Hinsicht das luftig-transparente The Bioluminescence of the night, in dem Horner mit verspielten Klängen von Glocken, Triangel und zärtlicher Solo-Violine die Magie des fluoreszierenden Nachtlebens stimmungsvoll einfängt. Alle Elemente kulminieren zum ersten Mal so richtig, wenn Sully seinen Ikran bändigt und mit dem Vogel in die Lüfte steigt und die Musik diesen besonderen Moment in Jake’s first Flight mit dem majestätischen Hauptthema (ab 0:58 Min.), vollem Orchester und “hawaiianischen” Chören feiert.
Das Hauptthema mit seiner ungewöhnlichen Harmonik ist ein starker melodischer Einfall, den Simon Franglen als identitätsstiftendes Element auch in der Musik zur Fortsetzung wieder aufgreift. Vor allem erinnert er direkt an keine andere Horner-Musik, was im Spätwerk des Komponisten doch eher ungewöhnlich ist. Doch natürlich geht es in Avatar nicht ohne Selbstzitate. Gleich mehrfach setzt Horner das berüchtigte Gefahrenmotiv ein, hier aber eher als Symbol für bereits erfolgte Zerstörung. Die Shakuhachi-Flöte darf ebenfalls nicht fehlen und die Vokalisen im Stile der Sängerin Enya haben natürlich in Camerons Titanic (1997) ihr großes Vorbild. All das lässt sich kaum leugnen. Und trotzdem stimmt die Mischung, alle heterogenen Teile fusionieren zu einer charismatischen Klangsprache, die eng mit der Filmwelt verknüpft ist und die man in der Rückschau nach nur wenigen Takten problemlos Camerons Blockbuster zuordnen kann. Besonders deutlich wird dies auch in den ausschweifenden Action-Stücken, in denen der archaische Kriegsgesang des Chores, Shakuhachi-Flöte und Trommeln bruchlos mit dem Orchester verschmelzen. Das Schaustück in dieser Hinsicht ist das fulminante, elfminütige War für die finale Konfrontation von Militär und den versammelten Na’vi-Stämmen, die sich auch musikalisch in der Gegenüberstellung von militärischer Rhythmik und Klangexotik spiegelt. Wie sich hier die einzelnen Schichten überlagern, unermüdlich vorangetrieben vom im Stakkato singenden Chor, Fanfaren und Percussion – auch etwas elektronische Rhythmik ist mit dabei – beeindruckt, weil Horner dabei die thematische-motivische Arbeit nie vernachlässigt. Reizvoll auch, wie er das Stück mit der Solo-Violine schließlich ganz leise ausklingen lässt.
Wenn es einen größeren Kritikpunkt gibt, dann ist es der, dass über dem Abspann sofort I see you von Leona Lewis zu hören ist. Zwar basiert dieser obligatorische Filmsong auf Horners Hauptthema. Doch die seichte Pop-Sensibilität wirkt angesichts der Welt von Pandora völlig deplatziert und nimmt zudem James Horners Filmmusik die Möglichkeit, zu einem befriedigenden dramaturgischen Schluss zu kommen. Das Lied holt den Zuschauer unsanft aus dem filmischen Sog und erinnert leider noch einmal an das kommerzielle Kalkül, welches Avatar zugrunde liegt. Zweifellos ist James Camerons Film in technischer Hinsicht mit seinem audiovisuellen Weltenbau ein absoluter Meilenstein des Kinos, der hervorragendes Unterhaltungskino bietet, nicht weniger als das. Und doch überschreitet die New-Age-Ästhetik Pandoras immer wieder die Grenze zum Kitsch. Hinter dem eher schlichten Eskapismus-Angebot steckt letztlich nur wenig Substanz. James Camerons Inszenierung und James Horners Oscar-nominierte Filmmusik wissen dies nur – und das ist ihr Verdienst – äußerst clever zu kaschieren.
Diskografische Notizen:
Der Soundtrack zu Avatar wurde 2009 auf einer 78-minütigen CD veröffentlicht, die alle Höhepunkte von Horners Komposition vereint. Ein paar Monate später wurde im Frühjahr 2010 eine “Deluxe Edition” ausschließlich zum Download angeboten, die 6 weitere Stücke (etwa 20 Minuten) anbietet. Diese ergänzen die CD-Fassung durchaus sinnvoll, sind aber streng genommen nicht wirklich essenziell.




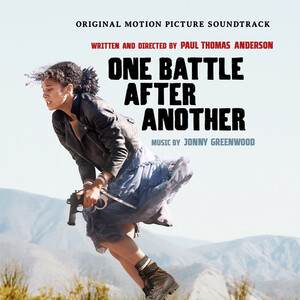
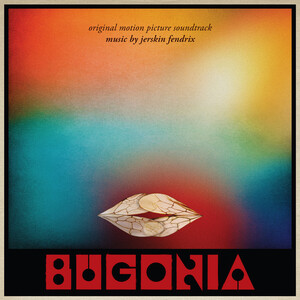

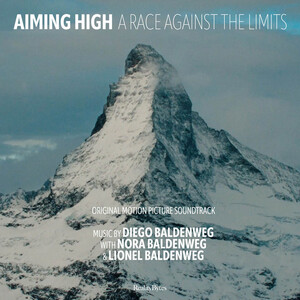
Mir stellt sich die Frage, was hier als Hauptthema gesehen wird. Das, was in “Jakes first Flight” und vorher schon in “Climbing up Iknimaya” zu hören ist – und hier empfiehlt es sich, kurz das Thema von “Glory” gegenzuhören -, ist ja ein anderes als das, was nachher im Titelsong umgesetzt wurde (und mich in den ersten beiden Akkorden doch sehr an “My heart will go on” erinnert).
Aber wer Horner anheuert, kriegt halt Horner, und das bedeutet, dass man immer wieder Versatzstücke aus anderen Scores hört bis hin zur Piccoloflöte, die sich an “Mighty Joe Young” annähert. Muss ja nicht heißen, dass sie deshalb schlecht ist.
Ich meine schon das Liedthema, das man in „Climbing up Iknimaya“ ab 1:33 im Chor hört bzw. in „Jakes first Flight“ ab circa 0:58 Min. Das durchzieht ja in Variationen und Andeutungen sehr viele Stücke. Das wird ja auch auf dem Soundtrack-Tracklisting beim Song als “Theme from Avatar” bezeichnet.
Glory gehört zu den Horner-Musiken, die ich am wenigsten kenne, weil ich den Film auch noch nicht gesehen habe. Ist aber definitiv vorgemerkt für eine Kritik in den nächsten Monaten.