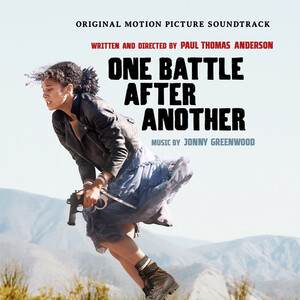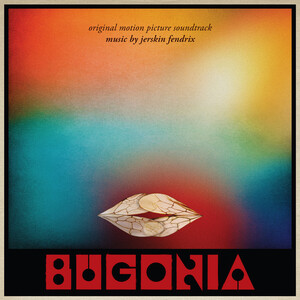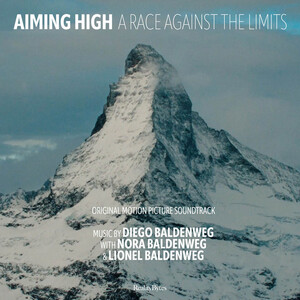Im Jahr 1963 veröffentlichte der Thriller-Autor Alister McLean den Roman Eis Station Zebra. In dem Buch verarbeitete er die weltweite Verunsicherung im Kalten Krieg, die sich damals nach der Kuba-Krise auf einem Höhepunkt befand. Als Inspiration für die Handlung diente ihm offensichtlich die erfolgreiche Mission “Operation Coldfeet” von 1962, in der zwei Fallschirmspringer des amerikanischen Geheimdienstes am Nordpol über einer verlassenen russischen Forschungsstation abgesprungen waren. Sie hatten dort drei Tage verbracht, um Dokumente und Ausrüstung sicherzustellen, die schließlich mit Heliumballons in die Luft getragen wurden, um von einem modifizierten Flugzeug eingefangen zu werden. Dadurch erhielten die USA wertvolle Erkenntnisse über die russische Arktisforschung und ihre Versuche, U-Boote unter Eis zu lokalisieren. Um ein U-Boot geht es auch in Eis Station Zebra und seiner 1968 in die Kinos gekommenen Verfilmung von John Sturges (Die glorreichen Sieben, Gesprengte Ketten), die zumindest in der Grundprämisse miteinander übereinstimmen: Der Kapitän Ferraday (Rock Hudson) wird mit seiner Crew auf einen mysteriösen Auftrag geschickt: Er soll den MI6-Agenten Jones und eine Truppe Soldaten zum Nordpol bringen. Den Grund (den es so im Roman nicht gibt) erfährt er erst viel später: Eine Satellitenkapsel mit wertvollen Geheimdienstinformationen zu Raketenbasen auf beiden Seiten ist dort abgestürzt. Es beginnt ein Wettlauf um die Zeit. Wer wird bei unwirtlichen Bedingungen als Erstes vor Ort sein? Und welchen Crew-Mitgliedern an Bord des U-Bootes Tigerfish kann man auf der beschwerlichen Reise wirklich trauen?
Eis Station Zebra entstammt mit seinem epischen Anspruch der guten alten Hollywood-Schule. Die Geschichte vermag auch heute noch zu fesseln. Die Szenen unter Eis, in denen das U-Boot eine dünne Stelle zum Auftauchen sucht, sind ebenso spannend wie die Spurensuche in der Arktis, in der ein Feuer das Lager zerstört hat und von der Kapsel jede Spur fehlt. Aber gleichzeitig schwingt dabei immer auch eine gewisse Naivität mit. Das U-Boot erscheint etwa viel zu geräumig, als dass wirklich eine klaustrophobische Atmosphäre entstünde. Drollig auch die Szene, in der die Soldaten fragen lassen, ob man an Bord rauchen dürfe. Und geradezu rührend wirkt das letzte Filmdrittel bei der Eisstation, in denen keiner ernsthaft zu frieren scheint, obwohl gerade noch ein heftiger Polarsturm wütete. Kein Wunder: Die Schauspieler dürften eher ziemlich geschwitzt haben: Der Nordpol entstand nämlich komplett aus Styropor als gigantischer Studioset in den MGM-Studios. Real und wirklich beeindruckend sind dagegen die Außenaufnahmen auf hoher See, bei denen man mit neuen Kameratechniken an einem echten, von der US-Navy geliehenen U-Boot experimentierte. Licht und Schatten liegen hier also dicht beieinander. Eis Station Zebra ist natürlich zwangsläufig auch ein Kind seiner Zeit und so ist es keine echte Überraschung, dass der Film etwas Patina angesetzt hat. Gleichzeitig wird aber passables Starkino geboten, was nicht zuletzt an der charismatischen Leinwand-Präsenz von Patrick McGoohan als MI6-Agent und dem einen russischen Doppelagenten spielenden Ernest Borgnine liegt. Besonders raffiniert ist die Schlusspointe, bei der beide Seiten den Konflikt in der Öffentlichkeit als Zeichen der gemeinsamen Zusammenarbeit und Zeichen der Völkerverständigung herunterspielen.

Bei der Wahl des Filmmusik-Komponisten trafen die Produzenten eine ungewöhnliche Wahl. Sie entschieden sich für den Franzosen Michel Legrand, der 1964 mit dem Musical Die Regenschirme von Cherbourg Weltruhm erlangt hatte. Eine überraschende Entscheidung, denn Legrand war zu diesem Zeitpunkt eigentlich eher für seine Songs und Jazz-geprägten Musiken bekannt. Eistation Zebra war seine erste groß-dimensionierte Hollywood-Produktion, bei der er mit einem 75-köpfigen Orchester arbeiten durfte – eine Herausforderung, die der Komponist begeistert annahm. Vielleicht liegt es auch daran, dass die triumphale Fanfare, die das U-Boot immer dann begleitet, wenn es spektakulär durch die Wellen bricht, für einen derart sinistren Agententhriller im Kalten Krieg eine Spur zu euphorisch und heroisch anmutet. Ohnehin fällt die Musik immer wieder aus dem Rahmen, weil Legrand zwar durchaus Klischees bedient, sich dann aber doch wieder über weite Strecken abseits vertrauter Vertonungsschablonen bewegt. Das zweiteilige Hauptthema, das aus der genannten Fanfare und einer warmen Streichermelodie besteht, besitzt zwar großen Wiedererkennungswert. Doch sobald die Tigerfish unter Wasser taucht, verlässt Legrand seine Komfortzone. Anstatt den Suspense-Plot mit Jazzrhythmen im James-Bond-Modus zu begleiten, wie sie John Barry oft in den 60ern verwendete, vertont Legrand die fremdartige Welt der Tiefe unter dem ewigen Eis und die unwirtliche Umgebung der Arktis mit sperrigen, impressionistischen Klangmalereien. Eigentlich ist das eine clevere Idee. Die Agenten mit ihren staatstragenden Aufträgen werden an einen unwirklichen Ort geführt, an dem die großen politischen Intrigen und die Scharmützel auf der Weltbühne klein erscheinen angesichts der unkontrollierbaren Naturgewalten. Allerdings geht die Rechnung nicht vollständig auf. Gerade in der ersten Hälfte braucht der behäbige Film recht lange, um seine Geschichte überhaupt in die Gänge zu bringen. Und die Musik nimmt in ihren avantgardistischen Klängen oft zusätzliches Tempo aus der Inszenierung.

Dennoch erzeugt Legrand mit seiner detailverliebten Komposition eine charismatische, träumerische Stimmung, die auch heute noch in den Bann schlägt. Nur gelegentlich werden die atmosphärischen Stücke von stärker militärischen Akzenten, sinistren Streichern und manchmal auch melodramatischen Idiomen, wie sie in der Zeit typisch waren, aufgebrochen. Im Booklet der vorzüglichen, leider längst ausverkauften FSM-CD von 2003, mit der erstmals der komplette Score vorlag, ist die Rede von einem Ballett des Kalten Krieges. Das mag blumig klingen, trifft aber den Punkt. Denn es ist gar nicht so einfach, Legrands Musik in all ihren versonnenen Stimmungen und Wendungen zu erfassen. Mitunter verliert sie sich geradezu in entrückten Klangwirkungen. Da gibt es Wasser-Gongs, Vibrafon und verschiedene Arten von Percussion-Effekten zu hören. Das passt nicht nur hervorragend zur lebensfeindlichen Umgebung der Arktis, sondern bildet auch ein perfektes Sinnbild für die einsame, nicht minder kühl-feindselige Welt der Agenten.
Doch wenn die Handlung zu Beginn des zweiten Aktes Fahrt aufnimmt, zieht Legrand ebenso kräftig die musikalischen Zügel an. Großer Höhepunkt in dieser Hinsicht ist das 12-minütige Schaustück Entr’Acte/Crewman falls into Crevasse/Tigerfish Emerges in dem Legrand den Marsch der Männer zur Eisstation mit schroffen Action-Rhythmen unermüdlich vorantreibt, bis dann am Ende frenetische Beckenschläge das U-Boot durch das Eis brechen lassen. Angesichts einer so kühl-sperrigen Klangkulisse könnte der Kontrast kaum größer ausfallen, wenn Legrand dann unvermittelt mit dem Hauptthema wieder zu einem klaren, markanten Ausdruck findet und den Zuschauer daran erinnert, dass er sich in einer großen Hollywood-Mainstream-Extravaganz befindet. So steckt in Legrand Ice Station Zebra letztendlich beides: eine spröde, experimentelle Tonschöpfung, die ihrer Zeit voraus war, und zugleich eine Filmmusik, die sich eindeutig im Zeitgeschmack der 60er Jahre verankert – wenn man hört, wie die Streicher in den Spannungsszenen spielen oder die Blechbläser im Hauptthema Heldenmut und Abenteuergeist feiern. Doch gerade diese eigenwillige Kombination – gepaart mit einer lustvollen, geradezu verspielten Detailverliebtheit in der Instrumentierung, macht die besondere Faszinationskraft von Legrands charismatischer Filmmusik aus.