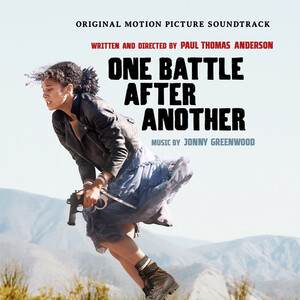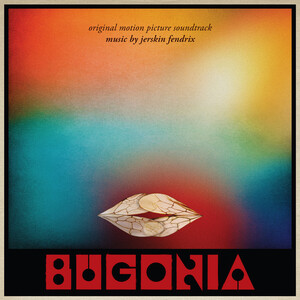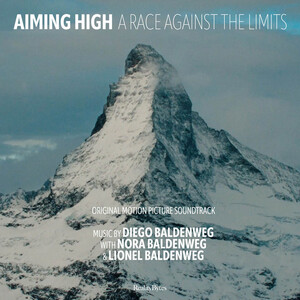Eines muss man M. Night Shyamalan lassen: Auch wenn seine Filme oftmals an verschiedenen Problemen kranken, etwa durch unglaubwürdige Wendungen oder eine inkonsistente Tonalität irritieren, hat der umstrittene Regisseur Risiken nie gescheut. Das gilt selbst für seine letzten, meist von der Kritik gescholtenen Filme, ob Old, Knock at the Cabin oder nun Trap. Gemeinsam ist ihnen eine ungewöhnliche Grundprämisse, die faszinierende filmische Räume eröffnet, um etablierte Plotformeln auf frische Weise durchzuspielen. In Trap: No Way out von 2024 steht ein Serienkiller, der berüchtigte “Schlachter”, im Vordergrund, den die Polizei schon lange sucht, der sich dem Zugriff aber bisher immer entziehen konnte. Wer das ist, ist von Anfang an klar: Der nach außen sympathische und joviale Cooper (Josh Hartnett), der ein verstörendes Doppelleben führt. Tagsüber ist er der liebende Familienvater und nachts ein gnadenloser Serienkiller. Als “guter Papa” begleitet er seine nichts ahnende Teenager-Tochter Riley zu einem Konzert der angesagten R&B-Sängerin Lady Raven. Doch genau dieses Konzertevent vor 3000 Zuschauern entpuppt sich für ihn als Falle: Das FBI hat nämlich einen Hinweis bekommen, dass der gesuchte Straftäter ein Ticket erworben hat, und riegelt nun hermetisch alle Ein- und Ausgänge der Halle ab.
Derart in die Enge getrieben, muss Cooper kreativ werden, um sich der Ergreifung zu entziehen. Dabei darf seine Tochter aber auf keinen Fall erfahren, dass ihr geliebter Daddy in Wirklichkeit ein schreckliches Doppelleben führt. Natürlich ist Trap nicht der erste Thriller, der seine Geschichte aus der Perspektive des Täters erzählt oder mit einem Großereignis verknüpft (man denke nur an Bodyguard oder Sudden Death). Dennoch werden diesen Handlungsmotive geschickt variiert: Hier soll kein Attentat verübt oder verhindert werden, sondern der Täter will unbemerkt fliehen. Und auch um heimliche Sympathien mit dem Antagonisten geht es nicht: Von Anfang an erzeugt Shyamalan ein schleichendes Unbehagen. Die selige Riley wähnt sich an einem der schönsten Tage ihres Lebens, darf sogar zusammen mit Lady Raven auf der Bühne tanzen. Doch als Zuschauer kann man sich nicht mit ihr freuen, weil man längst weiß, dass sich dieses unbeschwerte Glück über kurz oder lang in einen schrecklichen Albtraum verwandeln wird.
Lady Raven – alias Shyamalans Tochter Saleka – ahnt dies in ihren Songs auf der Bühne bereits voraus, singt in Release von einer schwierigen Vater-Tochter-Beziehung, wie ihr Vater die Familie einst verließ und sie ihm nun vergeben kann. Sie fordert ihr Publikum auf, ebenfalls einem Menschen zu verzeihen und dies mit einem Licht zu signalisieren. Alle Lampen im Saal leuchten, nur Coopers nicht. Daraus resultiert eine spannende Doppeldeutigkeit: das Unverständnis des Vaters seiner Teenager-Tochter gegenüber und darüber hinaus die Frage, ob Riley ihm einmal wird verzeihen können. Die extravagante Inszenierung des Konzerts, das in einer echten Halle mit echtem Publikum gedreht wurde, gehört ohnehin zu den Stärken des Films. Den Superstar im Stil von Ariana Grande nimmt man Saleka alias Lady Raven mit ihren eleganten R&B-Songs jederzeit ohne Probleme ab und der heimliche Kommentar der Texte zur Filmhandlung erzeugt dazu eine raffinierte Meta-Ebene.

Herdís Stefánsdóttir, die hier nach dem vielversprechenden Knock at the Cabin zum zweiten Mal mit Shyamalan zusammenarbeitet, hat es in ihrer Originalmusik ungleich schwerer. Es liegt in der Natur der Sache, dass die von Saleka selbst komponierten Songs in der ersten Filmhälfte breiten Raum einnehmen. Dadurch ergeben sich aber für Komponistin zwangsläufig wenig Möglichkeiten, eine eigene Musikdramaturgie zu etablieren. Und in den Szenen nach dem Konzert ist vor allem gefordert, auf der Tonspur die Spannungskurve nachzuzeichnen. Das tut die Isländerin durchaus kompetent, in einem unterkühlten Nordic-Noir-Stil, der wie schon in Knock at the Cabin elektronische Drones und Drumpads mit dem Spiel des Orchesters verbindet. Stefánsdóttir hat in einem Interview erklärt, dass ihre Komposition durch mehrere Charakterthemen den Wechsel der Perspektiven in der Filmhandlung spiegelt. Doch davon ist in der Praxis wenig bis gar nichts zu hören. Die Leitmotive lassen sich bestenfalls erahnen. Selten blitzt überhaupt einmal eine motivische Idee auf, wie das vermutlich der Profilerin Dr. Grant zugeordnete Klavierthema in Dr. Grant Here, das an The Sixth Sense erinnert und in Main Street Part in einem Arrangement mit Hans-Zimmer-Inception-Vibes wieder auftaucht. Überdies gibt es keinerlei Bezugspunkte zu den Saleka-Songs, sodass die Musik beider Filmhälften doch deutlich auseinanderklafft. Das mag so gewollt sein, um die liebevolle und abgründige Seite Coopers auf der Tonspur mit zwei unterschiedlichen musikalischen Welten gegenüberzustellen. Doch letztendlich führt dieser Gedanke nirgendwohin, weil der Film in einem eher banalen Finale mündet.
Wer auf die Shyamalan-typischen Katharsis-Szenen mit einem besonderen Twist wartet, der wartet in Trap ohnehin vergeblich. Die ein oder andere Wendung ist zwar vorhanden. Doch dies sind eher Scharmützel im Katz-und-Maus-Spiel zwischen Psychopath und seinen Opfern und keine alles verändernden Erkenntnisse. Und so gibt es auch für Herdís Stefánsdóttir im Finale nur wenig zu holen. Ihre kurzatmige Musik bleibt durchgehend anonym und fällt damit deutlich hinter ihre thematisch stärkere Arbeit zu Knock at the Cabin zurück. Allerdings ist Trap auch der deutlich schwächere Film. Wenn das Drehbuch im letzten Filmdrittel immer wieder neue Haken schlägt und es damit hoffnungslos übertreibt (alberner Höhepunkt ist die Szene mit dem Kinder-Fahrrad am Ende), ist nämlich nicht mehr viel von der cleveren Meta-Ebene der Konzertsongs übrig. Das ist schade, weil die Begegnung des Superstars mit dem Serienkiller durchaus das Potenzial geboten hätte, die heile, emotional aufgeladene Popwelt auf die abgründige Realität des Killers prallen zu lassen. Dann hätten auch die Songs womöglich mit der Originalmusik fusionieren können. So aber stehen beide Ebenen ohne Verbindung nebeneinander. Unter dem Strich hinterlassen diese Inkonsistenz und dazu zahlreiche plotholes deshalb – wie so oft beim Regisseur – einen zwiespältigen, unausgegorenen Eindruck. Shyamalan bleibt ein erstklassiger Suspense-Regisseur, das beweist er auch hier in zahlreichen Szenen, die durchaus fesseln. Dies gilt aber nur dann, wenn man bereit ist, sich auf die verschlungenen Pfade und Perspektiven seiner mal reizvollen, mal ungelenken Inszenierung einzulassen. Denn bei allem Scheitern: Langweilig ist auch dieser Shyamalan-Thriller keine Sekunde lang.