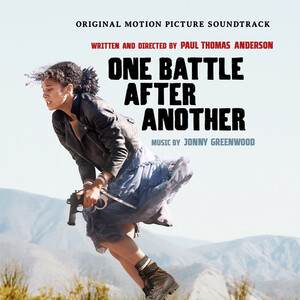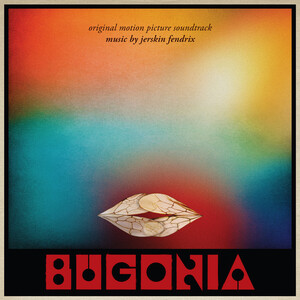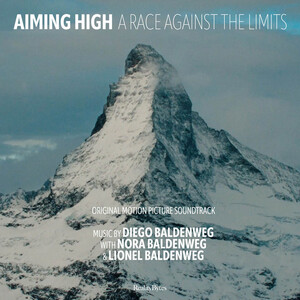„Komm zurück, Shane“, brüllt der kleine Joey dem verletzten Revolverhelden am Ende von Mein großer Freund Shane hinterher. Doch der verzweifelte Ruf verhallt wirkungslos in der Prärie, der Held reitet, ohne zurückzuschauen, dem Sonnenuntergang entgegen. Shane (Alan Ladd) ist der Archetyp des einsamen Cowboys, gezeichnet von der Vergangenheit und dem Streben nach Gerechtigkeit. Zu Beginn des populären Western-Klassikers von George Stevens stehen aber zunächst die Starretts im Mittelpunkt, eine von mehreren Siedlerfamilien in Wyoming Ende der 1880er Jahre. Der Homestead Act von 1862 brachte ihnen ein Stück Land, das sie nun fernab der großen Städte bewirtschaften. Dem vorher dort ansässigen Viehbaron Ryker sind die Bauern allerdings ein Dorn im Auge. Er beansprucht das ganze Land für sich und seine eigenen Geschäfte. Um die unliebsamen Neuankömmlinge zu vertreiben, ist ihm und seinen Mannen jedes Mittel recht, von Sabotageakten, Drohungen und Einschüchterungsversuchen bis hin zur Ausübung von Gewalt. Weil aber der nächste Marshall drei Tagesritte entfernt ist, sind die Siedler völlig auf sich alleingestellt – bis eines Tages der Loner Shane auf der Ranch der Starretts auftaucht und sich sofort auf ihre Seite stellt.

Vor allem der kleine Joey vergöttert den Fremden als Vorbild, zweite Vaterfigur, und bewundert dessen Künste mit dem Revolver. Shane will sich allerdings von seinem alten Leben als Pistolenheld lossagen, legt die Waffe beiseite und heuert auf der Farm als einfacher Arbeiter an. Doch als Zuschauer weiß man da schon, dass sich die Vergangenheit nicht so leicht abschütteln lässt. Der Konflikt ums Land, der als Johnson County War (1889–1893) in die US-Geschichte eingegangen ist, wird Shane dazu bringen, ein letztes Mal zum Revolver zu greifen, um die Kleinbauern von der existenziellen Bedrohung durch den Rinderbaron zu befreien. Auch wenn der Ausgang der Filmhandlung dabei vorhersehbar ist, verhandelt Shane dennoch eine Reihe universeller Themen, die nichts an Aktualität eingebüßt haben: So führt die Eskalation der Gewalt auf beiden Seiten zu Chaos und Todesopfern. Starretts Ehefrau Marian würde deshalb am liebsten alle Waffen aus dem Tal verbannen – eine pazifistische Einstellung, die angesichts der rauen Wirklichkeit wie ein frommer Wunsch anmutet. Auch wenn Shane als Film der 50er Jahre noch keine direkte Kritik an der gewaltsamen Form der Konfliktlösung formuliert, kratzt er dennoch merklich an der Oberfläche gelackter Heldenmythen. Besonders im Gedächtnis haften bleibt dabei eine Szene kurz vor dem Ende, in der sich Starrett und Shane prügeln: Die Pferde drehen durch, die Kühe zerstören in ihrer Panik die Zäune. Marian und Joey schauen völlig fassungslos und verzweifelt zu, wie sich die beiden engen Freunde unerwartet mit Fäusten begegnen. Die fatale, destruktive Wirkung der Gewalt wird dabei besonders eindringlich in Szene gesetzt.
Das Handeln der Erwachsenen spiegelt sich zugleich in der unschuldigen Perspektive des kleinen Jungen, der mit großen Augen und ehrfürchtiger Faszination zum treffsicheren Revolverhelden Shane aufschaut. Wenn er „Peng, peng!“ rufend über die Ranch rennt und seine Mutter damit zur Weißglut treibt, zeigt sich bereits, wie sich die gewaltsame Konfliktlösung als archaisches Grundprinzip von Generation zu Generation weitervererbt. Gleichzeitig braucht es aber offensichtlich Menschen wie Shane, die sich gegen Despoten vom Schlage Rykers zur Wehr setzen und in den Kampf ziehen. Das daraus resultierende moralische Dilemma zwischen dem Wunsch nach Frieden und der Notwendigkeit zur Selbstverteidigung galt damals wie heute. Hier folgt der obligatorische Showdown aber noch den üblichen Genrekonventionen: Im Saloon trifft sich Shane mit dem Desperado Jack Wilson (Jack Palance) und Ryker zum finalen Shootout. Trotz der subtilen Untertöne steht Shane damit in der Tradition klassischer Hollywood-Western. Dies zeigt sich auch in den filmischen Mitteln: Die Oscar-prämierte Kameraarbeit von Loyal Griggs setzt die Farm vor der Bergkette der Rocky Mountains am Horizont in leuchtenden Technicolor-Farben in Szene. Die schwelgerische Filmmusik von Victor Young tut es dem gleich. Das wunderbar elegische Hauptthema (auch unter dem Namen The Call Of The Far-Away Hills bekannt) feiert die Besiedlung des „wilden Westens“, die beeindruckende Naturkulisse und den unermüdlichen Pioniergeist der Bauern. Ohne Frage: Shane zelebriert den Gründungsmythos der USA.

Darin zeigt der Film aber einen äußerst verklärten Blick, der Unangenehmes eher ausblendet. Die Vertreibung der indigenen Völker findet nur in einem kleinen Nebendialog Erwähnung und wird als Akt der Befreiung umdefiniert. Youngs Filmmusik verströmt – so attraktiv sie auch ist – vor allem Oberflächenglanz. Die feine Psychologisierung, die in der Geschichte durchaus angelegt ist, findet in seiner vorwiegend illustrierenden Musik kaum statt. Schön ist diese trotzdem: Das liegt nicht zuletzt auch an den reizvollen Nebenthemen: Für den kleinen Joey erklingt ein hüpfendes Celesta-Motiv. Marian wird durch eine orchestrale Verarbeitung des polnischen Tanzes Varsovienne (in obiger Suite ab 1:26 Min. / in den USA auch als Traditional Put your little foot populär) charakterisiert. Und wenn Starrett und Shane gemeinsam einen Baumstumpf umwuchten (The Tree Stump), erklingt eine kraftvolle Fanfare, die den Jubel darüber in die Welt herausschreit. Young lässt diese Leitmotive fließend ineinander übergehen. Besonders innig verschränken sichHauptthema und Varsovienne, umspielt von Mandoline und Akkordeon, bei der Essensszene gleich zu Beginn. Traditionals besitzen in der Filmmusik eine große Bedeutung. Der tapfere Farmer Torrey, der sich mit Ryker anlegt, erhält etwa das Stück Dixie als Leitmotiv, ein weiteres Zeichen für die tiefe Verwurzelung der Siedler in der eigenen Tradition. Schwächer fällt leider die Musik für die Antagonisten aus. Die Trennlinie zwischen gut und böse wird in Shane deutlich gekennzeichnet. Ein absteigendes 3-Notenmotiv für Rykers Bande und ein marschartiges Motiv in den Hörnern für den Pistolenheld Wilson stehen in scharfem Kontrast zur pastoralen Grundstimmung der lyrischen Stücke. Vor allem Rykers Spannungsmotiv wird oft ohne große Variation wiederholt und wirkt dementsprechend statisch. Victor Young war eben doch vor allem ein großer Melodiker. Besonders deutlich wird dies nochmals in der anrührenden Schlussszene, in der eine besonders lyrische Variante des Hauptthemas den verwundeten Helden gen Sonnenuntergang schickt und der kleine Joey ihm mit Tränen in den Augen hinterherblickt. Sein Ruf „Komm zurück, Shane“ verhallt unerhört. Und am Ende steht die Erkenntnis, dass Kinohelden und Filmmusiken wie diese nicht zurückkommen.
Diskografische Notizen

Für viele Jahre blieb die Filmmusik zu Shane unveröffentlicht, bis La-La-Land Records 2012 eine restaurierte Fassung herausbrachte. Diese auf 2000 CDs limitierte und längst ausverkaufte Edition ist zwar äußerst lobenswert, leidet aber unter zahlreichen altersbedingten Anomalien. Die Originalbänder müssen sich in einem eher bedauernswerten Zustand befunden haben. Wer auf die komplette Musik verzichten kann, der findet auf dem Kompilations-Album Shane – A Tribute to Victor Young eine vorzügliche 14-minütige Suite (siehe YouTube-Video oben), eingespielt von Richard Kaufman mit dem New Zealand Symphony Orchestra, die alle zentralen Höhepunkte der Musik in kompakter Form vereint.