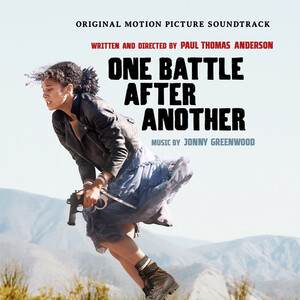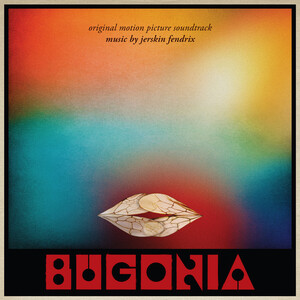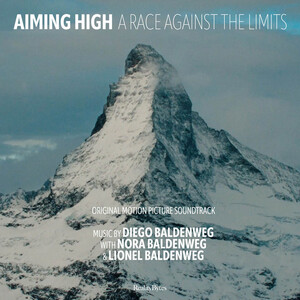In der anrührenden Vokalise im Titelstück der Filmmusik zu Die Quelle der Frauen, La Source, drückt sich beinahe das ganze Leid der Welt aus. Das anrührende Drama, angesiedelt in einem kleinen Bergdorf irgendwo im Maghreb, klagt unerträgliche Zustände an: Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Frauen, die das Wasser für das Dorf von der weit entfernten Quelle holen. Weil es Tradition ist, fällt ihnen seit jeher diese beschwerliche Aufgabe zu. Selbst Schwangere müssen – ohne jegliche Rücksicht seitens der Männer – die Strapazen in der gleißenden Sonne auf sich nehmen. Da verwundert es nicht, dass Fehlgeburten an der Tagesordnung stehen. Als wieder einmal eine Frau ihr Kind verliert, hat die progressive Leila (Leïla Bekhti) genug: Sie begehrt auf und bringt die Frauen im Dorf dazu, ihren Ehemännern den Sex zu verweigern, solange sich nichts ändert. Eine Revolte mit Folgen: manche Männer greifen zur Gewalt, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Andere ächten Leila und selbst ihr eigentlich verständnisvoller Mann gerät zunehmend unter Druck innerhalb der Gemeinschaft.
Doch die Mühlen mahlen langsam in dieser scheinbar von der Außenwelt abgeschnittenen Region. Die nächste Stadt ist weit weg.Handy-Empfang gibt es nur an einem einzigen Platz am Ort, sofern man denn Glück hat. Der rumänische Regisseur Radu Mihăileanu (Zug des Lebens) hat die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte von der Türkei nach Marokko versetzt, nicht ohne aber voranzustellen, dass sie sich so auch in vielen anderen Regionen der Erde abspielen könnte. Das ist ein cleverer Schachzug. Denn zum einen entzieht er sich damit einem zu engen Realitätsanspruch und zum anderen erlaubt es der Kameraarbeit von Glynn Speeckaert, eindrucksvolle Bilde zu produzieren: Die bunten Gewänder der Frauen ergeben vor den sandigen Bergen des Atlas einen farbenfrohen Kontrast. Das Aufbegehren mischt sich in Die Quelle des Lebens mit einer guten Portion Lebensfreude. Da gibt es wunderschön fotografierte Einstellungen der Frauen beim gemeinsamen Tanzen und Singen, bei denen die umgedichteten Liedtexte zu einem originellen feministischen Manifest werden.

Das wirkt mitunter fast zu schön, um wahr zu sein, und trägt natürlich auch leicht märchenhafte Züge. Man fragt sich deshalb als Zuschauer zwangsläufig, wie viel diese filmische Wahrheit mit der wirklichen Lebensrealität zu tun haben mag. Zweifellos ist richtig, dass Frauen in solchen traditionell lebenden Dorfgemeinschaften oft unter patriarchalen Strukturen mit religiös geprägten Moralvorstellungen und konservativen Rollenmodellen leiden. Das Grundanliegen von Die Quelle der Frauen besitzt insofern also eine universelle Relevanz. Doch gleichzeitig gerät das hier gezeichnete Bild von starrköpfigen Männern, die aus Tradition ihre Frauen zum Wasserholen schicken und damit großen Gefahren für Leib und Leben aussetzen, während sie faul am Dorfplatz herumlungern, schon arg plakativ. Im Westen rennt der Film mit seinem Anliegen ohnehin offene Türen ein. Der zentrale Konflikt des Drehbuchs erzeugt wenig Spannung, weil jeder halbwegs vernünftige Mensch mit den Frauen sympathisieren dürfte und zudem von Beginn an klar ist, dass Leilas Kampf am Ende von Erfolg gekrönt sein wird. Weil das allein aber noch keinen zweistündigen Kinofilm füllt, gibt es deshalb verschiedene romantische Subplots, die sich am Ende genauso einfach in Luft auflösen wie der zentrale Handlungsstrang ums Wasserholen. Irgendwie will Die Quelle der Frauen eben auch optimistisch stimmendes Wohlfühlkino bieten. Doch so ganz passt das nicht zum harten Realismus. Besonders eklatant fällt dieser Widerspruch in den Nachtszenen auf, in denen Leila wiederholt anhören muss, wie ein Mann seine Frau vergewaltigt – ein Trauma, welches sich schwerlich allein mit ausgelassenem Tanz und fröhlichem Gesang bewältigen lässt.
Dass sich Mihăileanus Film dennoch authentischer anfühlt, als er vermutlich ist, liegt nicht nur am Dreh am Originalschauplatz, sondern vor allem an der Musik von Armand Amar. Der in Jerusalem geborene Komponist ist spätestens seit Bab’ Aziz (2004) und Va, Vis et Deviens (2005) für seine charismatischen, von Weltmusik und Minimalismus geprägten, Klanglandschaften bekannt, die den von ihm betreuten Projekten oft eine betörende, unnachahmliche Aura verleihen. Das gelingt ihm auch bei Die Quelle der Frauen: Duduk und Oud verströmen über den Streichern der Prager Philharmoniker bereits mit den ersten Takten ein Gefühl schwebender Zeitlosigkeit, durchzogen von Melancholie und Gleichmut. Das geschieht fernab jeglicher Hollywood-Orient-Klischees, eng verbunden mit der traditionellen marokkanischen Folklore. Dies drückt sich auch in den rhythmisch geprägten Stücken aus, die sich ausgehend vom unwiderstehlich lakonischen Ranoucha immer mehr in die Dramaturgie hineinarbeiten. Dies kulminiert schließlich in Le Combat und Chez l’Imam, in denen sich die zentralen Konflikte auch auf der Tonspur dramatisch zuspitzen und die Folklore plötzlich überraschend als Spannungsuntermalung fungiert. Das gilt insbesondere für Chez l’Imam, in dem die Vokalise Leilas weibliche Stimme im Disput mit dem Dorfoberhaupt spiegelt.
Solche Spannungsmomente währen aber letztlich nur kurz. Und dann sind sie wieder da, die staubigen Klänge der Wüste, die wehklagenden Gesänge und das sehnsuchtsvolle Spiel verschiedener Streichinstrumente – von Cello und Geige bis hin zu Arpegina (eine Violine mit 5 Saiten) und Kamantsche (eine iranische Stachelgeige). Natürlich hat Armand Amar bereits eine ganze Reihe stilistisch ähnlicher Filmmusiken komponiert. Die Quelle der Frauen unterscheidet von sich von diesen Arbeiten – oft für Dokumentarfilme – jedoch in zweierlei Hinsicht: zum einen durch die traditionellen Chorgesänge, die auf der Soundtrack-CD einen gewissen Anteil einnehmen, zum anderen durch den fast völligen Verzicht auf minimalistische Elemente, wie man sie bei Amar, etwa bei Die Erde von oben oder Human häufiger vorfindet. Allein im Thema für Leila und Sami (Leila et Sami) klingt dieser Stil an. Ansonsten steht die Folklore im Vordergrund. Ähnlich wie bei seiner noch etwas charismatischeren Vertonung zum philosophischen Wüstendrama Bab’ Aziz gelingt Amar durch diesen Fokus eine ganz besondere Klanglichkeit, die – eine gewisse Offenheit für marokkanische Musik vorausgesetzt – eine große Faszinationskraft entfaltet.