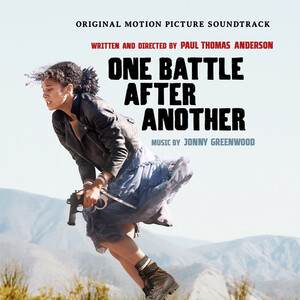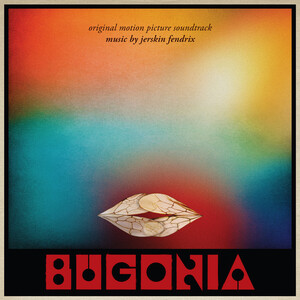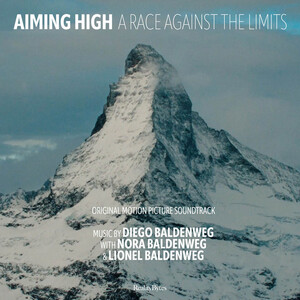Das zentrale Thema von Ari Asters Regiedebüt Hereditary – Das Vermächtnis ist die Angst vor der Vergänglichkeit: Nach dem Tod der eigenen Mutter muss Annie Graham (herausragend: Toni Collette) machtlos mit ansehen, wie ihre Familie nach und nach von einer undefinierbaren bösen Macht heimgesucht und zerstört wird. Diesen Kontrollverlust porträtiert Aster in symbolträchtigen Bildern: Annie ist Künstlerin und konstruiert virtuose Puppenhäuser als Abbild ihrer Realität. Doch die Inszenierung verwischt immer wieder die Grenzen zwischen diesen bizarren Miniaturwelten und dem Haus, in dem die Familie wohnt. Gleich zu Beginn verwandelt sich etwa ein Spielzeug-Schlafzimmer in den echten Bettraum der Grahams. Später wird Annie mutwillig alle ihre Modelle zerstören. Die Kontrolle über ihr Leben und ihre Familie ist ihr zu diesem Zeitpunkt längst entglitten. Wie alle guten Horrorfilme hat Hereditary damit viel mit der Realität, in der wir leben, zu tun. Der Verlust von Halt in einer vergänglichen, aus den Fugen geratenen Welt, die sich weder überblicken noch steuern lässt, ist ein Grundthema, welches sich in vielen Horrorfilmen beobachten lässt. Insbesondere bietet sich ein Vergleich zum im gleichen Jahr entstandenen Science-Fiction-Drama Annihilation an, in dem eine mysteriöse Wolke genetische Mutationen erzeugt. Mehr noch als in Alex Garlands Film gründet der cineastische Albtraum bei Aster aber in der Realität. Der Schrecken und das Toxische wurzeln im Stammbaum der Hauptfiguren. Es entspringt aus dem Inneren und wird von Generation zu Generation weitergegeben – wie auch der Filmtitel Hereditary, der so viel wie “vererbt” heißt – bereits andeutet.
Asters Film nimmt sich in der ersten Stunde ungewöhnlich viel Zeit, die Familienmitglieder mit ihren Sorgen, Nöten und der Sprachlosigkeit untereinander vorzustellen. Sie alle sind normale Menschen, keine Superhelden, die ernsthaft in der Lage wären, den Kampf gegen das Böse aufzunehmen. Annies Mann Steve (Gabriel Byrne) glaubt nicht einmal an das Übersinnliche und bleibt bis zuletzt skeptisch. Und ihr Sohn befindet sich wie die meisten Teenager auf der Suche nach der eigenen Identität und vergisst darüber die Menschen um ihn herum. Das wird das Unheil auf dramatische Weise befördern. Ein tragischer Unfall treibt einen massiven Keil in den Familienzusammenhalt, sodass keiner mehr dem anderen traut. Diesem Prozess der Zersetzung einer dysfunktionalen Familie beizuwohnen, erzeugt ein Gefühl beklemmender, klaustrophobischer Spannung. Aster verzichtet dabei über weite Strecken auf klassische Schockeffekte. Das Grauen entfaltet sich stattdessen genauso schleichend wie unaufhaltsam. Eine echte Chance auf ein Entkommen – so viel wird schnell klar – gibt es nicht.
Die eindringliche Wirkung von Hereditary hat auch viel mit der Musik des Newcomers Colin Stetson zu tun. Stetson, von Hause aus eigentlich Saxofonist und Solo-Musiker, der bereits mit der Indieband Arcade Fire auf Tour ging, ist einer der vielen filmmusikalischen Quereinsteiger der letzten Jahre, die einen unverbrauchten Zugang zur Vertonung eines Kinofilms mitbringen – und vor allem aus diesem Grund überhaupt erst ausgewählt wurden (ähnlich wie Son Lux bei Everything Everywhere All at Once). Seine Arbeit für Hereditary gründet sich in der musikalischen Avantgarde und verwischt abermals die Grenzen zwischen Musik und Sounddesign. Wie das Duo Barrow & Salisbury in Annihilation nutzt auch Stetson die Klänge analoger Instrumente, hier hauptsächlich Saxofon und Holzbläser, um sie in der digitalen Nachbearbeitung bis zur Unkenntlichkeit zu verfremden. “Wenn man in der Filmmusik etwas hört, was wie Geigen klingt, handelt es sich definitiv nicht um Geigen, und was wie ein Synthesizer klingt, sind in Wirklichkeit leise Holzbläser.” erklärte der Kanadier zum Kinostart sein besonderes Vorgehen. Eine interessante und ungewöhnliche konzeptuelle Idee. Doch so gut das in der Theorie klingt: Im Film spielt dieser Kunstgriff im Grunde keine große Rolle. Man nimmt man vor allem das Geräuschhafte und die klirrend-kalt brodelnden Klangflächen wahr, von denen ein Gefühl omnipräsenter Bedrohung ausgeht. Das Ziel ist klar: die Verunsicherung des Zuschauers. Die Musik gibt keinen Halt, wo es auch für Annie und ihre Familie keinen gibt.
Das liegt nahe, führt allerdings zu einem grundlegenden Problem: Es gibt in der Musik keine Entwicklung, keine echte Bezugnahme zur Handlung oder den Figuren. Das mag auch daran liegen, dass Asters Film über das großartige Schauspielensemble und die virtuose Kameraarbeit hinaus seltsam inhaltsleer bleibt. Wenn man einmal verstanden hat, wie ausweglos die Abwärtsspirale ist, verpufft im Grunde auch schon die ganze Spannung. Der fatale Determinismus des Horrors beißt sich ab da merklich mit der Tragödie einer dysfunktionalen Familie, aus der sich wenig ableiten lässt, weil es am Ende der Teufel ist, der die Strippen im Puppenhaus zieht. Das gilt umso mehr, als das Drehbuch in der zweiten Hälfte viele abgedroschene Stereotype bemüht. Da wird allen Ernstes ohne jegliche ironische Brechung noch einmal eine Seance mit Gläserrücken aufgeführt. Die Dämonen schweben im weißen Gewand unter der Decke, und zur Teufelsanbetung werden die Kerzen im Kreis angezündet. So ernst Hereditary in der ersten Hälfte das eigentliche Familiendrama anlegt, so bieder und albern wirkt der faule Budenzauber um den Dämon Paymon, bei dem am Ende irgendwie auch egal ist, wer da nun von wem Besitz ergreift und warum das eigentlich gerade geschieht.
Auch musikalisch läuft das in die Leere. Zur finalen Wiedergeburt (Reborn) lässt Stetson die Bläser in spätromantischer Weise eng angelehnt an das Vorspiel aus Wagners Rheingold (und in Verbindung zum verwandten Stück Mothers & Daughters früh im Film) aufspielen. Es sind bizarr-helle Klangfarben, die in einer euphorisierenden Sirene mit E-Gitarren münden. Eine seltsame Wahl. Denn wie die Musik hier bitterböse die Wiedergeburt des Teuflischen feiert, erscheint angesichts des traurigen Familiendramas dann doch völlig unpassend. Hereditary wirft die Frage auf, was wir angesichts der unvermeidlichen Vergänglichkeit des Lebens – symbolisiert durch den Dämon – an die Menschen weitergeben, die nach uns kommen. Die filmische Antwort darauf ist eindeutig pessimistisch. Zelebrieren muss man das aber trotzdem nicht. Doch was bleibt dann von der Filmmusik übrig? Es brodelt, sägt und wummert. Aber letztendlich ist auch das nicht wirklich etwas Neues mehr – in der klassischen Moderne ebenso wenig wie in der Filmmusikgeschichte. Colin Stetsons erste große Filmmusik tut mit den Bildern effektvoll das, was sie soll – Schrecken und Unbehagen verbreiten. Doch darüber hinaus weiß sie nichts über die Figuren und die Handlung zu erzählen. Und das ist dann doch vor allem eines: erschreckend wenig.