Eine Besonderheit der Filmmusik von Jerskin Fendrix zum Kritiker-Darling Poor Things von 2023 war es, dass sie die Innenwelt der Hauptfigur nach außen kehrte und mit ihrem kindlichen Blick die Welt entdeckte – was sich direkt auf der Tonebene übertrug. Auch im neuen Film des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos (The Favourite) ist das gewissermaßen der Fall: Die Musik blickt in den Kopf von Teddy (Jesse Plemons), der mit seinem geistig zurückgebliebenen Bruder Don in einem kleinen Haus auf dem Land lebt. Und Teddy ist etwas Großem auf der Spur oder meint es zu sein: Er glaubt, dass Michelle Fuller (Emma Stone), die Chefin des Biomedizin-Unternehmens Auxelith, in Wahrheit eine böse Außerirdische ist, die die Menschen als Versuchskaninchen missbraucht. Dagegen muss natürlich etwas getan werden. Kurzerhand entführen Teddy und Don die junge Unternehmerin, die sich plötzlich gefesselt und kahl geschoren im Keller der beiden Verschwörungstheoretiker wiederfindet und den beiden verzweifelt versucht klarzumachen, dass sie kein Alien aus der Andromeda-Galaxie ist.

Doch wie spricht man mit Querdenkern, die sich so sehr in ihrem Weltbild verrannt haben, dass sie fest glauben, im Recht zu sein und für das Gute zu kämpfen? Michelle fühlt sich den beiden Hinterwäldlern intellektuell komplett überlegen. Doch mit ihren Argumenten stößt sie gegen eine Mauer aus dickköpfigem Unverständnis. Was sie aber nicht ahnt: Ihr Biokonzern hat durchaus einen Anteil an der Situation der Brüder. Denn ein von Auxelith auf den Markt gebrachtes Medikament hat bei Teddys und Dons Mutter (Alicia Silverstone) schreckliche Nebenwirkungen verursacht. Seitdem liegt sie im Krankenhaus im Koma, ohne Aussicht auf Heilung. Dieser Schicksalsschlag hat die Welt für die beiden Männer aus den Fugen gerissen, während Michelle den Konzern mit neoliberaler Härte und Pseudo-Political-Correctness ohne Rücksicht weiterführt. Der Kapitalismus als Brandbeschleuniger für den Wahn von Verschwörungstheoretikern – das ist eine der vielen Ebenen von Lanthimo’s schwarzhumoriger Groteske, die natürlich auch suggeriert, dass sich eine Gesellschaft, die nicht mehr auf den Einzelnen aufpasst und nur noch als zahlenden Konsumenten sieht, nicht wundern muss, wenn sich diejenigen, die ausgegrenzt werden oder sich ausgegrenzt fühlen, gegen diese Ungerechtigkeit aufbegehren – auch wenn dies hier natürlich mit illegitimen, völlig durchgeknallten Mitteln geschieht.
So verschiebt sich in Bugonia schleichend die Bedeutungshoheit. Sind Teddy und insbesondere Don nicht doch mehr Opfer als Täter? Und verhält sich die wenig empathische Michelle nicht tatsächlich selbst schon fast wie ein Alien, angesichts der Tatsache, dass ihre Firma Auxelith Menschen und Umwelt nachhaltig schadet? Zwar erscheint sie zunächst als “Stimme der Vernunft” im Gegensatz zu den Schwurbeleien Teddys und erhält so zwangsläufig alle Sympathien des Publikums, doch sie hat sich im Grunde genauso weit vom Humanismus entfernt wie ihr Gegenüber. Emma Stone und Jesse Plemons spielen das großartig. Plemons verleiht Teddy eine perfide Mischung aus labiler Selbstüberschätzung und Einfältigkeit. Und Stones Michelle beeindruckt mit dem Kalkül des CEO-Sprechs, das auch schon mal dazu führt, dass sie Teddy genau das sagt, was er hören will. Es bereitet ein Riesenvergnügen, den beiden Ausnahmeschauspielern bei diesem eigenwilligen Psychoduell zuzuschauen. Das Drehbuch kennt dabei keine Gnade und treibt die Handlung in immer neue absurde Höhen voran.
Besondere Beachtung verdient in diesem Kontext auch die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte der Filmmusik von Jerskin Fendrix. Giorgos Lanthimos gab dem Komponisten, ohne mehr vom Projekt zu verraten, den Auftrag, Musik zu den drei Begriffen “Bienen”, “Keller” und “Raumschiff” zu schreiben, versehen mit dem Hinweis, dass die Komposition bombastisch werden solle. Fendrix ging in Klausur, betrieb einschlägige Recherchen und kam schließlich mit seiner einstündigen Filmmusik zu Bugonia um die Ecke, die in Demoversionen bereits beim Dreh verwendet werden konnte. Bei einer solchen Vorgehensweise versteht es sich fast von selbst, dass die Vertonung in eine besondere Beziehung zum Leinwandgeschehen tritt und nicht synchron zur Inszenierung agieren kann. Was Fendrix geschaffen hat, hat entsprechend wenig mit einer klassischen Musikdramaturgie zu tun, auch wenn mit dem London Contemporary Orchestra ein 90-köpfiges Orchester zur Verfügung stand. Nach einprägsamen Hauptthemen oder Leitmotivik, braucht man also nicht zu suchen (wenngleich es wiederkehrende Motive gibt). Fendrix’ Arbeit steht ganz in der Tradition der modernen Musik des 20. Jahrhunderts. In der stampfenden Rhythmik mag man an Schostakowitsch denken, und wenn sich bizarre Sound-Cluster zu lauten Crescendi auftürmen, fühlt man sich auch unweigerlich an John Coriglianos oder Elliot Goldenthals karnevaleske Filmkompositionen der 1990er Jahre erinnert.
Es ist schon bemerkenswert, wie der erst 35-jährige Fendrix sich nach Poor Things ein weiteres Mal traut, sich weit vom üblichen Hollywood-Sound zu entfernen und die Tendenz der letzten Jahre zu immer mehr atmosphärischem Sounddesign zu unterlaufen. Effektvoll gelingt es ihm, den Wahn Teddys in musikalische Bilder zu verwandeln. Exemplarisch dafür steht das lyrisch aufblühende Grand Cycle in der Fahrradszene, das sich zu einer fulminanten Fanfare hinaufschraubt – und damit kongenial die Euphorie des sich in seinem Kopf als Held wähnenden Teddy verdeutlicht. In anderen Momenten sind es das dissonante Spiel der Streicher, manchmal auch schiefe Töne, die den lauernden Irrsinn und die Verblendung spiegeln. Das Crescendo in Basement etwa mutet wie ein musikalisches Sinnbild für Chaos und Überforderung an. In Tell Teddy I am sorry und Grand Tango, eskaliert die Musik mit immer schneller werdenden Schlagwerk-Rhythmen, dissonanten Streichern und schrillen “Blechbläser-Attacken”. Fendrix nutzt eine ganze Reihe ungewöhnlicher Spieltechniken der Instrumente. In einem Interview gab der Komponist an, als eher unerfahrener Dirigent vor das Orchester getreten zu sein, und dass dies aber eher von Vorteil gewesen sei, um den einzelnen Instrumentengruppen unübliche Klänge zu entlocken.
Es gibt breite Phasen, in denen sein Bugonia wie ein avantgardistisches Konzertwerk klingt. Dies gilt insbesondere für die originalen Album-Fassungen, die für den Film zum Teil stark eingekürzt wurden. Besonders reizvoll ist etwa das fünfminütige Star Saliva / Industry, welches mit einem rhythmischen Flötenmotiv beginnt, während im Hintergrund langsam das Orchester anschwellt und in einem grotesken Marsch mündet. Radikales Gegenstück dazu ist die rein elektronische “Raumschiff-Musik” im Spaceship, die mit ihrem Klischee-Futurismus im starken Kontrast zur restlichen Musik steht und die Idee von Michelles Mutterschiff fröhlich ad absurdum führt. Man mag kaum glauben, dass Fendrix beim Komponieren keine Idee hatte, worum es in Bugonia wirklich geht. So sehr passt seine Musik wie die Faust aufs Auge zur Psychologie von Teddy und seinem Bruder Don. In der Opulenz der klassischen Orchestermusik, steckt etwas von beider Naivität, aber auch von den hehren Zielen, die sie eigentlich verfolgen. Der Kontrapunkt und die sich überlagernden Klangschichten passen perfekt zur multimedialen Überforderung. Die Musik der Bienen (Bees), in der die Streicher das Summen imitieren, steht quasi für die vielfältigen “Stimmen im Kopf”. Die Dissonanzen untermauern den schleichenden Irrsinn. Und wenn die Musik mit frenetischen Rhythmen eskaliert, dann ist das gleichzeitig eine perfekte Metapher für den blinden Aktionismus, in den Teddy im Glauben, das Richtige zu tun, verfällt.
War Poor Things vor allem eine sehr funktionale Filmmusik, die man aufgrund ihres äußerst experimentellen Charakters kaum von den Bildern trennen konnte, funktioniert das in Bugonia deutlich besser. Leichte oder besonders zugängliche Kost ist die Komposition von Jerskin Fendrix deshalb aber noch lange nicht. Stattdessen erinnert der Newcomer eindrucksvoll daran, welche Ausdrucksmöglichkeiten ein Orchester besitzen kann, sofern der Komponist freie Hand bekommt und seine Chance zu nutzen weiß. Selten war das im US-Kino der letzten Jahre so aufregend zu hören wie hier. Auch wenn die unmittelbaren Vorbilder wie Elliot Goldenthal in ihren Werken doch noch etwas charismatischer waren und eine ausdrucksstärkere Handschrift aufwiesen, gehört Bugonia zweifellos zu den stärksten Filmmusiken des Kinojahres – selbst wenn es möglicherweise aufgrund durchwachsener Filmkritiken nicht ganz für eine Oscar-Nominierung reichen dürfte.




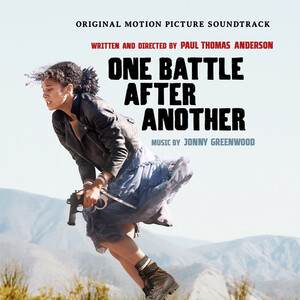
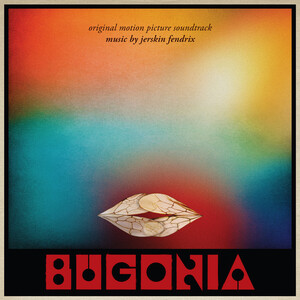

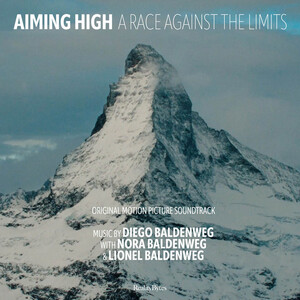
Aber welche sind die Karnevalseken?
Da würde ich Batman Forever empfehlen. Die Musik zum vierten Batman ist ja leider unveröffentlicht.
Welche Goldenthal-Filmmusiken sind zum Beispiel gemeint? Davon würde ich mir gerne ein Bild machen, um vergleichen zu können. Gehören “Titus” und “Final Fantasy” dazu?
Zu den stärksten Goldenthal-Filmmusiken würde ich In Dreams, Interview with the Vampire, Michael Collins, Sphere, Cobb und Final Fantasy zählen. Titus und Heat müsste ich mal wieder hören, auch im Kontext des jeweiligen Films.