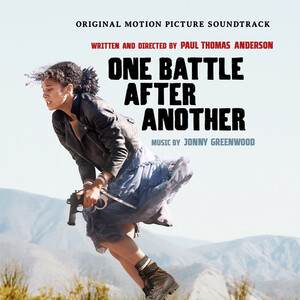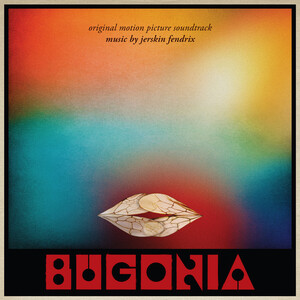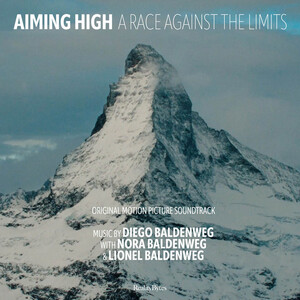Da ist es wieder: ein sich in die Gehörgänge hineinhämmerndes Fanal wie in Im Westen nichts Neues. Wieder stammt es von Volker Bertelmann. Und wieder geht es um einen fatalen, zerstörerischen Krieg. Der findet in Kathryn Bigelows A House of Dynamite allerdings nicht mehr auf den Schlachtfeldern statt, sondern in den Kontrollzentren und “Situation Rooms” der USA, in denen “Watch Teams” rund um die Uhr die politische Lage rund um den Globus überwachen. Und dort herrscht plötzlich Alarmzustand, als der Start einer mit Atomwaffen bestückten Interkontinentalrakete aus dem Pazifik gemeldet wird, Quelle unbekannt. Anfangs denken alle noch, es sei ein unangemeldeter Test. Spätestens aber, als die Waffe ihre Flugbahn verändert, und die Spezialisten einen Einschlag in 19 Minuten in Chicago prognostizieren, bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen. Doch welches Land hat den Angriff initiiert? Kam die Rakete aus Russland, China oder doch vielleicht Nordkorea? Und was ist nun zu tun? Wie reagiert man auf den Erstschlag eines nicht klar erkennbaren Angreifers? In wenigen Minuten greifen die Protokolle der Behörden für den Ernstfall: millionenfach wieder und wieder geprobte Abläufe, Rädchen, die ineinandergreifen, um sich der Bedrohung entgegenzustellen. Wie schon bei der Ergreifung Osama Bin Ladens in Zero Dark Thirty seziert Kathryn Bigelow das Getriebe der Macht, untersucht die Mechanismen der Gremien, die in kurzer Zeit Entscheidungen treffen müssen, die über das Schicksal aller Menschen auf der Erde bestimmen.

Das Drehbuch von Noah Oppenheim nähert sich diesem Schreckensszenario auf multiperspektivische Weise. Gleich dreimal wird die letzte halbe Stunde vor dem potenziellen Einschlag gezeigt, einmal aus der Sicht der wachhabenden Leiterin des Teams im “Situation Room” (Rebecca Ferguson), einmal aus der Perspektive des jungen Sicherheitsberaters Jake Baerington (Gabriel Basso) und zuletzt aus den Augen des US-Präsidenten (Idris Elba), der vor der finalen Entscheidung über den Gegenschlag steht. Doch die Inszenierung verweigert sich jeglicher Heldenzeichnung. Alle Protagonisten ringen selbst um Fassung, versuchen noch panisch, die Liebsten zu benachrichtigen. Auch wenn die Protokolle vorgeben, was zu tun ist, und gewisse Handlungsräume anbieten, existiert niemand, der im Sinne einer klassischen Hollywood-Dramaturgie automatisch die richtige Entscheidung treffen wird. Erschreckend ist, wie schnell die Welt in A House of Dynamite an den Abgrund der atomaren Katastrophe gerät und wie wenig es braucht, um die Lage eskalieren zu lassen. Natürlich muss man dem Film, der ohne Unterstützung der Behörden entstand, zu einem gewissen Grad glauben, dass alles im Krisenfall genauso oder ähnlich ablaufen würde. Kritik gab es unlängst vom Pentagon, das kritisch anmerkte, dass die Abfangraketen – anders als im Film dargestellt – stets ihr Ziel treffen würden. Natürlich ist auch das mit Vorsicht zu genießen.
Doch ganz unabhängig von der Frage nach der Realitätsnähe bietet Bigelows Film beklemmendes, hochspannend inszeniertes Kino. Durch die virtuose Montage und die präzisen Dialoge, die den Zuschauer mit ihren Abkürzungen und Fachtermini bisweilen durchaus herausfordern, verdichtet sich das entfesselte Kreisen um die Ausnahmesituation zu einem faszinierenden Blick auf politische Prozesse im Krisenmodus. Der daraus resultierende Schrecken hallt lange nach und erinnert darin sogar an den Katastrophenfilm The Day After. Frei von Schwächen ist Bigelows Film allerdings nicht. Vor allem im letzten Drittel fällt er leicht ab. Das liegt daran, dass inhaltlich von Iteration zu Iteration nur wenig Neues erzählt wird. Spätestens nach dem letzten Perspektivwechsel fühlt sich die Inszenierung sogar beinahe redundant an, weil nichts Relevantes hinzukommt und aufmerksame Zuschauer sich den Blickwinkel des Präsidenten bereits aus den vorher in der Videokonferenz gelieferten Bruchstücken zusammensetzen können. An der grundsätzlichen Intensität und filmischen Wucht ändert das unter dem Strich aber wenig. Dafür ist Kathryn Bigelow (Detroit, Strange Days) einfach eine viel zu starke Regisseurin, die weiß, wie man Spannung erzeugt und aufrecht erhält.
Gleichzeitig profitiert der Film von der effektvollen Musik Volker Bertelmanns, der in den vergangenen Jahren zu einem der gefragtesten Hollywood-Komponisten aufgestiegen ist. Angesichts der Radikalität der Vorlage verwundert es nicht, dass Bigelow den Deutschen verpflichtet hat, der bereits in Im Westen nichts Neues die Fatalität des Weltkrieges kongenial eingefangen hat. Wenn man so will, wiederholt dieser in A House of Dynamite das Oscar-bringende Erfolgsrezept des Kriegsfilms. Das in seiner Basis aus vier Noten bestehende Hauptthema (prominent zum ersten Mal zu hören ab 0:32 Min. in White House) wird ständig wiederholt, gleicht einer mahnenden Sirene, voller kühler Dringlichkeit und unbarmherziger Härte. Umrahmt wird das Motiv vom kraftvollen, an Clint Mansells Requiem for a Dream erinnernden Spiel der Streicher. Bis zu acht Kontrabässe und sechs Celli sind im Einsatz. Möglichst viel Power habe er in die Bässe kriegen wollen, wie Bertelmann in einem Interview verriet. Die Streicher geben den Bildern einen nervös-flirrenden Rhythmus – eine unterschwellige Unruhe, die durch eine Vielzahl geräuschartiger Effekte noch verstärkt wird. Wie in vielen seiner vorangegangenen Arbeiten entstand auch diese Musik mit sehr viel Nachbearbeitung am Computer. Der Einsatz von Baritonsaxophonen etwa lässt sich bestenfalls nur erahnen. Dennoch ist bemerkenswert, wie präsent und direkt die Celli klingen, offenbar ein bewusst eingesetzter Lautstärke-Effekt, um die Dringlichkeit der Lage zu unterstreichen.
So mischt sich das Sounddesign mit wiederkehrenden, rhythmisch eingesetzten, Streichermotiven. Im Film funktioniert das prima. Die “destabilisierenden Sounds”, wie sie Bertelmann nennt, nehmen dem Zuschauer jegliche Sicherheit. Und das ständige wiederholte Hauptthema erinnert vermutlich ganz absichtlich an den Wahnsinn von Im Westen nichts Neues. In Allow to Brief You passiert das sogar überdeutlich, weil die Klangschichten mit ihren dröhnenden Bässen nahezu austauschbar klingen. Aber das passt durchaus zum kriegsgeilen Verteidigungsminister, der mit aller Härte zurückschlagen will und den Präsidenten dementsprechend brieft. In nur wenigen Minuten wird in A House of Dynamite tägliche Routine zum Irrsinn eines atomaren Weltkrieges. Kein Wunder also, dass Bertelmanns Musik noch einmal erfolgreich und effektvoll in die gleiche Kerbe schlägt wie bei seinem Oscar-Gewinner. Die Musik teilt zwangsläufig das Repetitive der Vorlage. Das geht kaum anders, weil hier nicht Figuren, sondern Entscheidungsprozesse im Mittelpunkt stehen. Dennoch ist das aber nicht nur positiv zu sehen. Denn der Einfall mit dem monotonen, sich quasi in die Hörgänge bohrenden “Signalmotiv” nutzt sich nach einigen Stücken doch merklich ab. Auch wenn das prägnante Thema in No longer unimaginable noch einmal klangschön auf dem Klavier erklingt und so eine nachdenkliche, menschliche Note erzeugt, dreht sich Bertelmanns effektvolle Komposition – wie die filmische Vorlage – bei allen Qualitäten vielleicht doch ein paar Mal zu oft im Kreis.