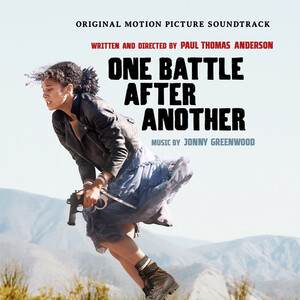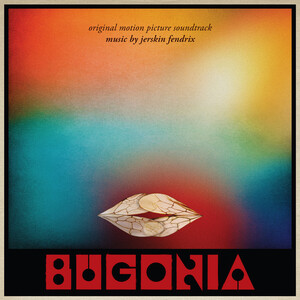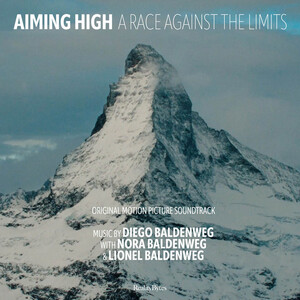“Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich” heißt es im ersten Satz von Tolstois berühmtem Roman Anna Karenina. Das Leben der beiden Geschwister Anna und Charlotte in Donkey Days ist dennoch in einem ganz besonderen Maße unglücklich. Beide leiden unter ihrer narzisstischen Mutter Ines, die bald ihren 85. Geburtstag feiert und ihre Töchter gerne zu “Pflichtbesuchen” um sich schart – bei gemeinsamen Familienreisen mit dem von ihr vorgegebenen Ziel Frankreich oder zu wiederkehrenden Festlichkeiten wie Geburtstagen oder Weihnachten. Dabei dreht sich alles um sie, die in einem einsamen Herrenhaus mit verwunschenem Garten thronende Matriarchin, die ihre Kinder ohne große Liebe aufzog und oft mit Abwesenheit glänzte, wenn ihre Töchter sie am meisten gebraucht hätten. Beide gehen sehr unterschiedlich mit der exzentrischen Dominanz der Mutter um: Während sich die attraktive Charlotte in ein beflissenes Leben der Selbstoptimierung geflüchtet hat, dessen äußerer Schein mehr als fragil ist, nagen an der übergewichtigen Anna Selbstzweifel und Verlustängste. Treffen alle aufeinander, dann gilt: Feuer frei für Seitenhiebe, Aggressionen, Beleidigungen und Manipulationen – ein verheerend toxisches Buhlen um Aufmerksamkeit, gegenseitigen Respekt und Anerkennung. Die niederländische Regisseurin Rosanne Pel findet dafür am Anfang ein starkes Symbolbild, wenn bei einem kulinarischen Dinner ein gemeinsames Nachtisch-Buffet aufgetragen wird, das alsbald einem Schlachtfeld gleicht – die Löffel kratzen auf dem Porzellan, die Gesichter essend in grotesker Nahaufnahme – bis nichts mehr übrig ist vom Dessert – wie von jedem in diesem unglückseligen Dreiergespann.
“Jedes Jahr ist es das Gleiche. Du heulst, ich heule oder wir heulen alle drei” sagt Anna einmal zu ihrer Schwester. Und das ist in Donkey Days Programm. Auf der Leinwand entfaltet sich ein Massaker psychischer Gewalt – gleichermaßen abstoßend, schwarzhumorig wie bitterböse. Der Film beobachtet sehr präzise die gegenseitige Dynamik zwischen Menschen, die sich nahestehen, die sich lieben und einander brauchen – deren Unfähigkeit, dies zu zeigen, aber ins völlige Gegenteil umschlägt. Rosanne Pel inszeniert das dysfunktionale Familien-Dreieck als surreales Kaleidoskop der Erinnerungsfetzen – benebelt vom allgegenwärtigen Alkohol- und Tablettenmissbrauch. Sie lässt die Kamera durch eine Art Geburtskanal fahren. Die auf einem Gemälde verewigte Ines blinzelt dem Zuschauer mitunter zu und manchmal taucht ihre jüngere Version wie selbstverständlich zwischen den erwachsenen Töchtern auf. Es gibt Auslassungen, Zeitsprünge und viele angerissene Erzählfäden. Ein Onkel ist verstorben. Die Asche muss abgeholt und im Meer verstreut werden. Die Mutter überweist zu aller Entsetzen einer zwielichtigen Eselfarm monatlich 100 € und bekommt dafür gemalte Bilder der Tiere zugeschickt. Anna verbringt die Nächte in Fetischclubs, wird von ihrer Freundin verlassen und diskutiert – sie ist Lehrerin – bei einer Konferenz über einen verhaltensauffälligen Schüler.

Doch leider tritt Donkey Days nach dem furiosen Beginn schnell auf der Stelle. Das liegt auch daran, dass das Drehbuch seinen Charakteren keinerlei Entwicklung oder Erkenntnis zugesteht. Der Film porträtiert einen festgefahrenen Istzustand, verweigert sich aber jeglicher Ursachenforschung. Zwar beeindruckt die schonungslose Ehrlichkeit, mit der Jil Krammer die Figur der Anna zum Leben erweckt – einen derart ungeschminkten Realismus findet man im Kino nur selten. Doch stellt sich die Frage, was Donkey Days über das quälende Zurschaustellen von Boshaftigkeiten und Grenzüberschreitungen hinaus eigentlich wirklich erzählen will. Weil das Drehbuch kaum eine Kausalität zu Ende denkt, es bei bloßen Andeutungen und fragmentarischen Beobachtungen belässt, dreht sich die Handlung ausschließlich im Kreis. Der Schatten der manipulativen Mutter ist so übermächtig, dass er das komplette Leben von Anna und Charlotte zerstört hat. Diese filmische Statik spricht beiden Frauen allerdings die Möglichkeit eines eigenverantwortlichen Handelns ab, reduziert sie allein auf banale Opferstereotype. Für den Film erweist sich das als fatal: Denn durch den Mangel an Empathie erscheinen weder Anna noch Charlotte in irgendeiner Weise sympathisch. Ihr Schicksal lässt völlig kalt. Und so wirkt Donkey Days am Ende wie eine toxische Familienfeier, zu der man am liebsten nie eingeladen worden wäre, die man im Kino aber nun irgendwie durchzustehen hat.