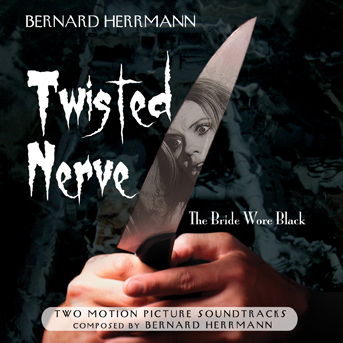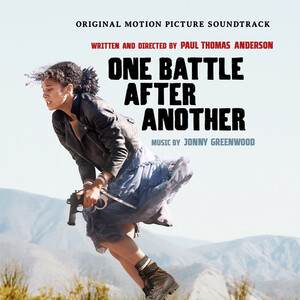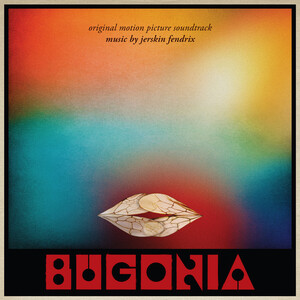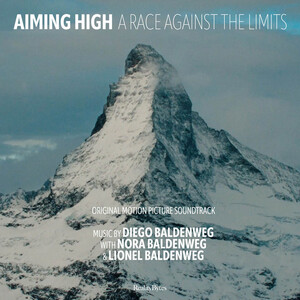Gäbe es nicht diese eine Szene in Quentin Tarantinos Kill Bill – Vol. 1, dann hätte sich wohl niemand an den Psychothriller Twisted Nerve von 1968 und die Filmmusik von Bernard Herrmann erinnert: Uma Thurmans Alter Ego Beatrix liegt in einem Krankenhausbett, während ihre Rivalin pfeifend über die Flure geht, langsam die “Todesspitze” aufzieht und plötzlich im Zimmer der “Braut” steht. Diese Krankenhausszene ist vor allem wegen des ikonischen Pfeifmotivs, das zunächst beinahe fröhlich klingt und sich nach und nach in ein bedrohliches, markerschütterndes Fanal verwandelt, berühmt geworden. Teufelskreis Y – Twisted Nerve, der originale Film, für den die markante Melodie eigentlich komponiert wurde, war zu diesem Zeitpunkt lange vergessen und ist es mehr oder weniger danach auch geblieben. Das mag daran liegen, dass das Drehbuch zu Roy Boultings Film bereits im Vorfeld des Kinostarts eine völlig berechtigte Kontroverse erzeugte, weil es tatsächlich mit der wissenschaftlich unhaltbaren Theorie spielt, dass es eine Verbindung zwischen dem Down-Syndrom und der genetischen Prädisposition eines Psychopathen gäbe. Schon vor dem Kinostart liefen verschiedene Verbände Sturm und veranlassten die Filmemacher dazu, der Aufführung eine den Sachverhalt klarstellende Texttafel voranzustellen. Am eigentlichen Inhalt wurde aber nichts verändert. Insofern überrascht es nicht, dass es aus heutiger Sicht nur wenig Interesse gibt, Twisted Nerve wiederzuentdecken.
Wenn man einmal über die offensichtliche “political incorrectness” hinwegsieht, weiß der Psychothriller allerdings durchaus zu fesseln: Im Mittelpunkt steht der von seiner Mutter verwöhnte und vom Stiefvater drangsalierte Martin (Hywel Bennett), der eine seltsame Charade als geistig zurückgebliebener Georgie spielt, um in die Nähe der von ihm angebeteten Susan Harper (der damalige Disney-Kinderstar Hayley Mills) zu gelangen. Weil er zusammen mit Susan bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde (sie ist allerdings unschuldig), will ihn sein Vater nach Australien schicken. Martin hat ganz anderes im Sinn: Seinen Eltern gibt er vor, nach Paris zu reisen, in Wahrheit kommt er aber bei Susans Familie unter, deren Mutter ihn zunächst aus Nächstenliebe aufnimmt. Doch das erweist sich als keine gute Entscheidung, denn hinter der kindlichen Fassade des naiven Blondschopfs mit den unschuldigen Augen verbirgt sich ein gestörter Psychopath, der des Nachts seinen ganz eigenen Rachefeldzug verfolgt. Ohne Zweifel ist das geschickt inszeniert, mit einem ruhigen Spannungsaufbau, der dank des starken Casts überzeugt: Hywel Bennett gibt den unbedarften Georgie so glaubhaft, dass man die rührende Anteilnahme von Susan und ihrer Mutter nachvollziehen kann. Obwohl man es natürlich besser weiß, möchte man als Zuschauer für einige Szenen sogar glauben, dass alles für Georgie auch gut ausgehen könnte. Diese Wirkung ist dann tatsächlich ein wenig “twisted”, wie der Filmtitel nahelegt.
Letztlich kann der Thriller seinen problematischen Schatten aber nie ganz ablegen. Zu ärgerlich ist es, wie das Drehbuch suggeriert, “das Böse” sei genetisch veranlagt und damit jeglichen sozialen Kontext ausblendet. Und dass hier Empathie für einen Hilfebedürftigen nach dem Motto “Pass auf, wen Du Dir ins Haus holst!” abgestraft wird, hinterlässt einen ebenso unangenehmen Beigeschmack. Wäre Twisted Nerve ein viel besserer Film, könnte man darüber vielleicht milde hinwegsehen. Wirklich ikonisch ist allerdings ausschließlich die Filmmusik, die durch Tarantinos Kill Bill eine späte Ehrenrettung erfuhr. Denn selbst Kevin C. Smith beschreibt in der Herrmann-Biografie A Heart at Fire’s Center dieses kleine Werk als “trauriges Echo der Trennung [von Alfred Hitchcock]”, spricht von einem “Eindruck der Langeweile” und Herrmanns am meisten selbstreferenziellen Werk bis zu diesem Zeitpunkt, was er vor allem auf Studiodruck zurückführt. Ein hartes Urteil, zumal der Autor dieses auch nicht wirklich mit Argumenten unterfüttert. Es stimmt natürlich, dass Bernard Herrmann hier das Rad nicht neu erfindet und in Twisted Nerve zahlreiche Stilmittel seiner früheren Kompositionen nachhallen. Und ebenso ist richtig, dass er nach dem Streit mit Hitchcock eine schwere Phase durchzustehen hatte, da sich der filmmusikalische Zeitgeschmack in den 60er-Jahren gewandelt hatte. Jazz und Easy Listening bekamen einen immer größeren Einfluss. Die alte Garde der Komponisten war kaum noch gefragt. Entsprechend kann man nur mutmaßen, ob Herrmann bei diesem Projekt auch unter anderen Umständen wirklich zugesagt hätte. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass er hier nicht bei der Sache war. Ganz im Gegenteil: Das gepfiffene Hauptthema ist ein großartiger Einfall, der Martins Psyche perfekt zwischen kindlich-fröhlicher Naivität und eiskalter Brutalität einfängt. Je nach Betonung und Instrumentierung verwendet Herrmann das Motiv mal in spielerischer und mal in bedrohlicher Weise. Es kann genauso gut von einem unbekümmerten Jungen auf der Straße gepfiffen werden, wie im nächsten Moment mit einer lang-ausgehaltenen Note, mit Dissonanzen oder einem “hämmernden Rhythmus” den lauernden Wahnsinn andeuten oder ihn gänzlich ausbrechen lassen.
Diese Dualität wird bereits im von Tarantino verwendeten Main Title spürbar. Das anfangs noch fröhliche Pfeifen, begleitet vom Vibrafon, verwandelt sich spätestens dann in Leinwandschrecken, wenn das kleine Orchester das Motiv übernimmt und in einen Mark und Bein durchdringenden Ausruf verwandelt – der an die Duschszene von Hitchcocks Psycho erinnert. Doch gleich in der Szene im Spielzeugladen arrangiert Herrmann das Thema in einer lyrischen Variante für Holzbläser. Dass auch an Twisted Nerve der Zeitenwandel nicht vorbeigehen konnte, beweisen Jazz- und Pop-Arrangements der Melodie, die vom damals noch jungen Howard Blake übernommen wurden, der in den Folgejahren eine eigene Karriere als Komponist fürs Kino und Konzertsaal verfolgen sollte. Insbesondere seine Jazzvariante belegt mit ihrem im Kontext ungewöhnlichen Einsatz der Harfe, die Universalität von Herrmanns Hauptthema. Besonders deutlich wird diese Vielseitigkeit auch in der Schwimmszene (Swimming/Drowning), in der Georgie und Susan zunächst einen vergnüglichen Tag am See verbringen und Herrmann mit Harfe und Celesta einen so überschwänglichen Optimismus verbreitet, dass man schon beinahe die Hochzeitsglocken läuten hört, und das Hauptthema plötzlich sogar vergnügt hüpfen lässt. Dieses selbstvergessene Idyll trügt natürlich, und das bleibt im Charakter der Melodie auch weiterhin angelegt. Welches düstere Potenzial das Hauptthema besitzt, zeigt sich schließlich im halbminütigen George’s Madness, in dem es von fiebrigen Dissonanzen durchsetzt, Martin in seinem ganzen Wahn offenlegt.
Bemerkenwert ist auch in Twisted Nerve die außergewöhnliche Orchestrierung. Komponierte Herrmann in Psycho budgetbedingt nur für Streicher, fehlen diese hier völlig. Stattdessen kommen zwei Celestas, zwei Vibrafone, vier Harfen und Hörner, verschiedene Arten von Becken, Flöten und Bassklarinetten zum Einsatz. Wenn Martin als Georgie in seiner “Gastfamilie” schöne Momente erlebt, dann spielen zwar die Holzbläser, doch es geht nie im Streicherwohlklang auf – so wie auch er zu keiner echten Empathie fähig ist. Allein schon diese wenigen Beispiele belegen, wie intelligent Bernard Herrmann die Musikdramaturgie für diesen britischen Thriller aus der zweiten Reihe angelegt hat. Auch wenn naturgemäß viele Orchesterkniffe schon aus seinen früheren Musiken bekannt sind, kann von einem schwächelnden Alterswerk deshalb eigentlich keine Rede sein. Letztlich hat wohl auch der umstrittene Ruf des Films die Rezeption der Musik zu Unrecht in Mitleidenschaft gezogen. Die kurze 28-minütige LP-Fassung (2009 von Kritzerland Records wiederveröffentlicht), in der die Jazz-/Pop-Stücke viel Raum einnehmen, hat zusätzlich nicht geholfen, den Eindruck nachhaltig zu verbessern. Erst die streng limitierte Sammeredition, 2016 von Stylophone (unsinnigerweise im teuren “Deluxe-Paket” mit der LP veröffentlicht), rückt das Bild endlich gerade. Doch leider fand ausgerechnet diese mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, richtete sich mehr an Vinyl-Fans und ist längst vergriffen. Aber irgendwie passt das auch ins seltsame Gesamtbild. Am Ende des Tages hätte Herrmanns Filmmusik wohl einen viel besseren Film verdient gehabt. Überspitzt formuliert könnte man sagen, dass sie bei Quentin Tarantino in ihrer düster-fröhlichen Abgründigkeit vielleicht sogar besser funktioniert, als im Film, für den sie eigentlich geschrieben wurde. Der bleibt nämlich am Ende kaum mehr als ein ziemlich irres “guilty pleasure”.
Twisted Nerve auf CD: