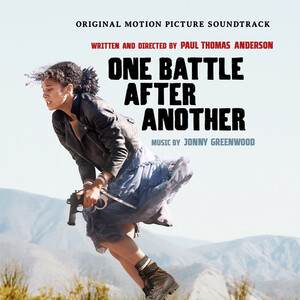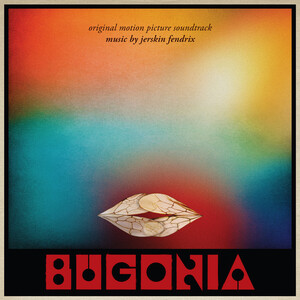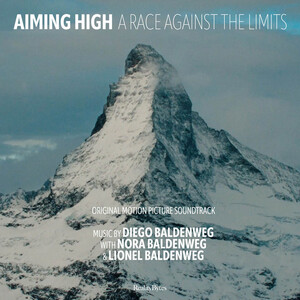Eigentlich war es ein erfolgreicher Dreh. Der letzte Take ist im Kasten. Die filmische Aufbereitung des Brandanschlags von Solingen, inszeniert vom türkischstämmigen Yiğit, kann bald Premiere feiern. Doch es gibt einen Eklat. Bei der Nachstellung des Brandes wurde ein Koran verbrannt. Einige der Komparsen sind entrüstet, sehen das als Respektlosigkeit und Beleidigung ihrer Religion. Es liegt eine nervöse Spannung in der Luft, doch alle sind nach dem langen, intensiven Arbeitstag müde. Die beflissene Praktikantin Elif (charismatisch: Devrim Lingnau Islamoğlu), die privat bei Yiğit und seiner Frau untergekommen ist, soll die Kassette mit den Filmrollen mitnehmen und vorher noch die Komparsen zurück ins Flüchtlingsheim fahren. Unterwegs verliert sie den Wohnungsschlüssel. Um ihr Missgeschick nicht zugeben zu müssen, verschweigt sie den Fauxpas. Ein verhängnisvoller Fehler, denn die Situation verschärft sich, als ein potenzieller Finder sich bei ihr meldet, und sie ihm leichtsinnig die Adresse des Regisseurs verrät. Als kurz darauf auch noch die Filmrollen verschwinden, eskaliert die Lage völlig, denn plötzlich geraten die Komparsen aus dem Flüchtlingsheim unter Polizeiverdacht, etwas mit dem Einbruch zu tun zu haben.
Was folgt, sind gegenseitige Beschuldigungen und Fremdzuschreibungen, fehlende Ehrlichkeit und spekulative Mutmaßungen. Mehmet Akif Büyükatalay legt mit Hysteria den Finger in die Wunde aktueller Gesellschaftsdiskurse, in denen oft übereinander, selten aber miteinander gesprochen wird. In denen es einfacher ist, Menschen in Schubladen zu stecken, als sich mit ihren Standpunkten auseinanderzusetzen oder andere Perspektiven auszuhalten. Dabei besitzen viele Dialoge spannende Subtexte. So kritisiert Mustafa gegenüber Elif, dass Yiğits Film nicht aus der Sicht der Betroffenen spreche und vor allem dafür da sei, das europäische Gewissen zu beruhigen. Gleichzeitig wird auch deutlich, wie schnell beidseitig Offenheit und Toleranz verschwinden, wenn diese Werte einer ernsthaften Belastungsprobe unterzogen werden, wenn sich die Paranoia vor die Vernunft schiebt. Da wird plötzlich die feine Trennlinie von Macht und Geld sichtbar. Sie verläuft selbst zwischen dem privilegierten Regisseur, der in zweiter Generation in Deutschland lebt, und den Flüchtlingen, deren Leben sich in einem Schwebezustand befindet und die befürchten müssen, dass man sie des Landes verweist, sollten sie straffällig werden.

Raffiniert und fast schon im Sinne eines Whodunit-Thrillers verschiebt das Drehbuch die Verdachtsmomente. Phasenweise erscheint ein jeder in Hysteria seine eigene undurchsichtige Agenda zu verfolgen und nicht mit offenen Karten zu spielen. Die Basis des gemeinsamen Miteinanders bricht dadurch nach und nach auseinander. Immer dann, wenn Büyükatalay diese allgegenwärtigen Dynamiken von Diskursen und Diskursverschiebungen untersucht, ist sein Film herausragend gut, stellt wichtige Fragen zur Kunstfreiheit, insbesondere in Abgrenzung zum Respekt vor religiösen Gefühlen, aber auch zu Machtverhältnissen und Rassismus. Leider schöpft der Film sein Potenzial dennoch nicht vollständig aus. Dies liegt vor allem an der etwas umständlichen, nicht immer schlüssigen Konstruktion: Dass man einer Praktikantin speziell im Kontext des “Koran”-Aufregers die Filmrollen anvertraut, dass sie ausgerechnet an diesem Abend die Schlüssel verliert und angesichts des großen Vertrauens zu Yiğit und Lilith beiden nicht sofort Bescheid gibt oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreift, um sich und die Wohnung vor einem Einbruch zu schützen, wirkt in dieser Zuspitzung weit hergeholt.
So kommt der Spannungsaufbau nur schleppend in Fahrt, ergibt sich die eigentliche Eskalation nicht organisch genug aus der Handlung. Spätestens, wenn sich die Beteiligten zum Finale in Yiğits Wohnung versammeln, um sich gegenseitig das letzte bisschen ihrer Fassade einzureißen, wirkt dies viel zu steif und bühnenhaft arrangiert. Man mag kaum glauben, dass sich alle nach dem bereits eskalierten Streit noch einmal gemeinsam an einen Tisch setzen würden. Doch Büyükatalay braucht diese Konstruktion zwingend, um einen dramaturgischen Zirkelschluss zum Filmbeginn ziehen zu können. Das macht inhaltlich viel Sinn, wirkt aber auf filmischer Ebene verkrampft. Hysteria liefert zwar wichtige Denkanstöße zur Diskussionskultur in unserer Gesellschaft und ist darum äußerst sehenswert. Doch leider geht das Konzept nicht vollständig auf. Diskurskino und Thriller stehen sich hier zu oft gegenseitig im Weg.