2011 gewannen Trent Reznor und Atticus Ross den begehrten Filmmusik-Oscar für The Social Network (2010). Und das zu Recht: Die Vertonung bestach in ihren raffiniert-versponnenen elektronischen Klangwelten als ebenso kluge wie pointierte Reflexion auf das Leben und Wirken des Facebook-Gründers David Zuckerberg. Der große Erfolg veranlasste Trent Reznor, eigentlich Mitglied der Kult-Band Nine Inch Nails, zusammen mit seinem Partner auch weiterhin Filmmusik zu schreiben. Doch was einmal prima funktioniert hatte, ließ sich nicht so ohne weiteres wiederholen: Bereits beim Fincher-Remake des skandinavischen Thrillers The Girl with the Dragon Tattoo (2011) wirkte die kühl-abstrakte Vertonung des Duos phasenweise fehl am Platze, erschien wie ein Fremdkörper, der wenig zur filmischen Wirkung beizutragen vermochte.
Auch die Filmmusik des Duos zum Thriller Boston (im Original Patriot’s Day) hinterlässt einige Fragezeichen. Um das zu verstehen, muss man zunächst aber auf die Vorlage blicken: Der Film, der nach nicht einmal vier Jahren den Terror-Anschlag auf den Boston-Marathon von 2012 aufbereitet, zeigt ein minutiös rekonstruiertes Porträt der Polizeiarbeit, die letztlich zur Verhaftung der beiden Attentäter führte. Peter Berg inszeniert das souverän, mit wenig Effekthascherei und phasenweise sogar bestechenden Szenen: Wie die Kamera die Konfusion nach der Detonation der Bomben einfängt oder den nächtlichen Shootout zwischen Polizei und Terroristen in nüchterne Bilder fasst, das beeindruckt. Hier zeigt sich die ganze Erfahrung des routinierten Action-Regisseurs, der die Ereignisse genauso professionell wie präzise nachzuzeichnen vermag. Und doch wird ihm diese handwerkliche Perfektion zum Verhängnis. Denn weil sich das Drehbuch aufgrund des geringen zeitlichen Abstands zu den Ereignissen und natürlich auch aus Pietät den Opfern gegenüber kaum von den belegten Fakten lösen mag, gelingt es Boston nicht, eine neue Perspektive auf die Tat zu eröffnen. Und in den wenigen Momenten, in denen sich das Drehbuch doch Freiheiten zugesteht, wird es sofort problematisch: Die Figur des von Mark Wahlberg gespielten Cops Tommy Saunders ist eine Fiktion, aus dramaturgischen Gründen zusammengeführt aus den Erfahrungen mehrerer damals im Einsatz befindlicher Polizisten. Auch wenn das den Zugang zum Film erleichtern soll, wirkt es doch kontraproduktiv in einer Produktion, die es ansonsten in fast allen Belangen penibel genau nimmt.

“Supergirl” Melissa Benoist in einer ungewohnten Rolle
Enttäuschend schemenhaft verläuft auch die Zeichnung der Terroristen, deren Hintergründe nebulös bleiben. Dies betrifft nicht nur die Täter, sondern auch die Frau des älteren Attentäters (Melissa Benoist). Ihr unterstellt das Drehbuch eine Mitwisserschaft. Die wird zwar tatsächlich vermutet, konnte bislang aber nicht nachgewiesen werden. Für Abgründe oder Ambivalenzen interessiert sich der Film ohnehin nicht ernsthaft. Boston feiert in erster Linie die bemerkenswerte Resilienz der Stadt angesichts der unerträglichen Gewaltakte, beschwört das emotionale „Wir“ gegen den potenziellen Feind von außen. Das ist einerseits verständlich, wirkt aber auch ein bisschen naiv angesichts der komplexen außenpolitischen Verstrickungen der USA, die in den letzten Jahrzehnten ihren Teil dazu beigetragen haben, dem Gedeihen von Extremismus einen Nährboden zu bereiten. Von solchen inhaltlichen Fragestellungen ist Peter Berg zwangsläufig weit entfernt. Niemand soll in seinen Gefühlen verletzt, irritiert oder unangenehm berührt werden. Und wer könnte ihm diese Einstellung auch verdenken angesichts eines nationalen Traumas, dessen Wunden noch lange nicht verheilt sind? Doch führt dies auch zur Frage, warum der Film eigentlich existiert. Filmisch mangelt es an einer eigenständigen Vision. Als Quasi-Dokumentation fehlt der nötige Realismus. Und als Trauerbewältigung mag man Boston mit seinen perfekt durchchoreografierten Action-Sequenzen erst recht nicht durchgehen lassen.
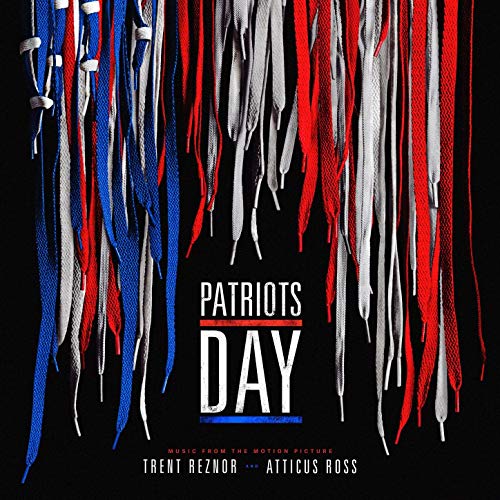
Und so verbirgt sich hinter dem hohen Produktionsniveau eine Richtungslosigkeit, die ratlos macht. Zwangsläufig färbt diese Unverbindlichkeit auch auf die Filmmusik ab: Reznor und Ross werden hier nämlich vor ein grundlegendes konzeptuelles Problem gestellt: Ihre Vertonung darf die Aufmerksamkeit nicht zu sehr auf sich lenken, um den pseudo-dokumentarischen Gestus nicht zu konterkarieren. Dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass sich die Musik vor allem darauf konzentriert, die Atmosphäre einzelner Szenen herauszuarbeiten. Und da blitzt die Könnerschaft der Komponisten-Duos dann doch auf: Vertraute Klänge verfremden, eigenwillige Klanggebilde kreieren – das ist eben ihre große Spezialität: Wenn sie mit schrillen, lang angehaltenen Tönen das lähmende Entsetzen nach den Explosionen akustisch erfahrbar machen, rhythmische Muster wie ein tickendes Uhrwerk einsetzen oder mit dem am Computer nachbearbeiteten Spiel des Klaviers die nachdenklichen Momente einfangen, dann verfehlt das nicht seinen Effekt. Die akustische Verfremdung als Sinnbild für eine im Augenblick verzerrte Welt, die quasi neben sich steht, das funktioniert auch in Boston exzellent.
Die Musik fügt sich mit dieser filmdienlichen Haltung bruchlos in die professionelle Hochglanz-Inszenierung ein. Doch mehr ist da kaum. Die elektronischen Klangflächen kommen den einzelnen Figuren nicht nahe, erzeugen weder Assoziationsräume noch Subtexte. Das ist auch nicht weiter überraschend. Denn obwohl alle Figuren auf realen Vorbildern basieren, flüchtet sich das Drehbuch im Detail in Stereotype, beschränkt sich allein darauf, aufrechte Amerikaner zu zeigen, die sich mit großer Entschiedenheit dem perfiden Anschlag und seinen Folgen entgegenstemmen. Am Ende werden die Bösen dingfest gemacht und alle schöpfen wieder Hoffnung. Brüche, unangenehme Wahrheiten oder andere Anknüpfungspunkte sucht man dabei vergeblich. Die Musik bleibt notgedrungen derart bildbezogen, dass selbst eingefleischte Fans der Komponisten nur irritiert mit der Schulter zucken konnten. The Social Network, das war aufregende Filmmusik. Mit Boston scheinen Trent Reznor und Atticus Ross hingegen endgültig im beliebigen Hollywood-Alltag angekommen zu sein.







