In den Augen der elfjährigen Pai-Kea (gespielt von der Debütantin Keisha-Castle Hughes) liegt alle Traurigkeit der Welt. Das junge Mädchen ist im männerdominierten Umfeld einer neuseeländischen Maori-Familie aufgewachsen. Tagtäglich bekommt sie – vor allem von ihrem strengen Großvater – zu spüren, was es heißt, ein unerwünschtes Kind zu sein. Denn ihr Zwillingsbruder, mit dem die Gemeinschaft die Hoffnung auf einen neuen auserwählten Anführer verband, ist bei der Geburt gestorben. In seiner Verzweiflung lehrt der Großvater nun in einer Schule die strengen, teils martialischen Rituale der Maori, um einen Nachfolger für den Stamm zu finden. Pai-Kea darf als Mädchen jedoch nicht am Unterricht teilnehmen, obwohl es ihr sehnlichster Wunsch wäre. So übt sie heimlich und übertrifft bald spielend ihre männlichen Altersgenossen. Trotz der fehlenden Anerkennung des Großvaters und großem Leidensdruck wächst sie – unbemerkt vom Familienoberhaupt – in das für sie bestimmte Schicksal hinein.
Niki Caro hat mit Whale Rider ein märchenhaftes Drama von geradezu mystischen Dimensionen gedreht. Anders als Lee Tamahori, der in Die letzte Kriegerin in kompromisslosem Realismus eine Maori-Familie zusammenbrechen ließ, sucht der Film nach der Aussöhnung zwischen Tradition und Moderne. Der Halt der Gemeinschaft in den gemeinsamen Wurzeln gibt die nötige Kraft für den Neuanfang. Darin liegt die sympathische, aber nicht unproblematische Botschaft des Filmes. Denn oftmals zeigt sich hier unterschwellig, dass sich der Mensch den starren Traditionen zu beugen hat und nicht umgekehrt die Tradition den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wäre Whale Rider nicht ein so ernsthafter, subtil erzählter Film und hätte er nicht eine so wundersame Hauptdarstellerin, die dem Projekt Rückgrat verleiht, so stünde der Whale Rider oftmals gefährlich nahe an der Grenze zum spirituell verklärten Ökokitsch.
Die Musik der Dead can Dance-Sängerin Lisa Gerrard spiegelt die Seelenlandschaft der Protagonisten mit einem weitgehend trüben synthetischen Klangteppich. In sirenenhaften Klängen verleiht sie den symbolträchtigen, fest in der Sagenwelt der Maori verankerten Walen, eine musikalische Stimme. Dazu gibt es ein fernes Echo der Maori-Gesänge, schlichtes Klavierspiel und dezente, entrückte Vokalisen. Nur selten gibt es etwas Auflockerung, etwa wenn Gerrard in Biking Home poppige Rhythmen mit Gitarre und ihrem Gesang verknüpft. Was im Film stimmungsvoll und unergründlich wirkt, funktioniert jedoch ohne Bilder kaum. Bereits im visuellen Kontext wirkt die Musik mitunter eine Spur zu trist und damit die Bilder zu wenig unterstützend. Ohne diesen verstärkt sich dieser Effekt und lässt die Arbeit an Eigenständigkeit vermissen. Hier zeigt sich, dass Lisa Gerrard noch über wenig Erfahrung als Filmkomponistin verfügt. Auch wenn es durchaus nette Momente in ihrer Musik gibt – vor allem in den Maori-Gesängen – bleibt der Whale Rider musikalisch äußerst blass und letztlich enttäuschend. Selbst als Filmsouvenir dürfte die CD kaum viele Hörer begeistern. Eine vertane Chance.
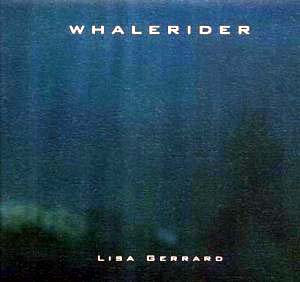







Neueste Kommentare